Interview with Heiner Blum
| Project/Occasion | artemak | |
| Interview with | Heiner Blum (HB) | |
| Conducted by | Erich Gantzert-Castrillo (EGC) | |
| Location | Offenbach am Main | |
| Date | August 25th-26st, 2008 | |
| Transcript | Birgitta Heid | |
| Document | Download as PDF | |
Techniques
Materials
EGC: Heiner, unsere erste Begegnung war 1987 bei der Ausstellung »Oktogon« im Museum Wiesbaden. Damals war ich als Restaurator am Haus, kurze Zeit später, 1988, ging ich an das neu entstandene Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt am Main. Du warst bei »Oktogon« beteiligt, und so lernten wir uns beim Ausstellungsaufbau näher kennen. In bleibender Erinnerung sind mir die stilistischen Veränderungen, die Du in den »Extra«-Ausstellungsräumen für Deine Installation Rotes Licht vorgenommen hast. Als erstes hast Du die Deckenlichtverkleidung entfernen lassen, wodurch die gesamte Beleuchtungsinstallation frei lag und die Räume ein eigenwilliges und gutes Ambiente bekamen. Der uns vertraute museale Stil in den »Extra«-Räumen des Museums wurde durch diesen einfachen Eingriff weggewischt. Des Weiteren ist mir die nicht zu überhörende, mir damals noch fremde Musik in Erinnerung, die Dich während des Aufbaus begleitete. Sie hat mir gefallen, ebenso auch die schwarze Kleidung, die Du damals getragen hast, und Deine stylisch frisierten schwarzen Haare.
HB: (schmunzelt)
EGC: Mein Gedanke war: Der Typ ist etwas Besonderes. Hier geschieht etwas mir unbekanntes. Alles war sehr eigenwillig und originell. Dieser Eindruck hat sich über die folgenden Jahre, in denen ich Deine künstlerische Entwicklung verfolgt habe, immer wieder bestätigt. Bis zu Deiner Ernennung 1997 zum Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und auch danach, entstand ein Oeuvre, das in der Zwischenzeit in einer kaum noch zu überschauenden Größe, Fülle und Diversität angewachsen ist. Mit diesem Interview möchte ich von Dir die Informationen zu Material, Technik, Entstehung und Erhaltung der Werke bekommen, die für viele Interessierte in der Zukunft von unschätzbarem Wert sein können. Die ersten Arbeiten mit denen Du bekannt wurdest, waren Fotografien aus dem Fotozyklus Menschen. Dafür erhieltst Du 1981 den Otto-Steinert-Preis der Deutschen Gesellschaft für Photographie.
Nach den fotografischen Arbeiten folgten Zyklen, die mit unterschiedlichsten Materialien, Techniken und Medien ausgeführt wurden, und weitere Preise, Stipendien und Ausstellungen im In- und Ausland sowie zahlreiche Arbeiten im öffentlichen Raum. Fangen wir mit den Fotoarbeiten an, mit dem Zyklus Menschen (1979-1982). Meine erste Frage dazu wäre: Wie sahen bei Menschen die Aufnahmeorte aus?
HB: Also, wie diese Fotos entstanden sind, willst Du wissen?
EGC: Ja, wo sie entstanden sind.
HB: Gut, also diese Fotos sind über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren entstanden, fast immer im Freien. Die Idee war, Menschengruppen so zu fotografieren, dass man den Ort, an dem das Foto entstanden ist, nicht sehen konnte. Erreicht habe ich das dadurch, dass ich die Kamera immer sehr tief gehalten habe, im Hintergrund sieht man dann meistens ein Stück vom Himmel. Das waren ganz spezielle Orte, an denen das besonders gut funktioniert hat. Mein Lieblingsort war zum Beispiel Kassel-Wilhelmshöhe, weil man dort am Hang Touristengruppen fotografieren konnte. Ich habe aber auch viel bei Karnevalszügen fotografiert oder in Fußgängerzonen. Die Idee war, ein Gefüge innerhalb von einer Menschenmasse von dem eigentlichen Geschehen zu abstrahieren, um bestimmte kommunikative Gesten oder eine bestimmte Mimik den Leuten abzulauschen. Das Ganze habe ich zunächst mit Kleinbild fotografiert und später, weil ich auf großen Detailreichtum immer mehr Wert gelegt habe, dann auch mit einer Mittelformatkamera.
EGC: Welche Kameras hast Du verwendet? Waren die von Nikon?
HB: Die Kleinbildkamera war eine Nikon, und später habe ich eine Mamiya Mittelformatkamera verwendet.
EGC: Und welche Objektive hast Du verwendet?
HB: Mir ging es darum – das war ein bisschen so ein Spiel –, selber mittendrin zu sein mit der Kamera, deswegen waren das immer leichte Weitwinkelobjektive. Ich habe, um den Ausdruck der Gesichter besonders genau erfassen zu können, immer mit Blitz gearbeitet, auch bei Tageslicht. Dadurch entstand eine gewisse Künstlichkeit und das Spiel war eben, dass ich eigentlich nur ein Foto machen konnte. Dann wurde ich als Fotograf entdeckt, weil ich die Leute aus zwei oder drei Metern Entfernung angeblitzt habe. Vorher habe ich versucht, mich ein bisschen zu tarnen.
EGC: Und wie waren die Reaktionen der Leute?
HB: Die Leute waren, wie man auf den Bildern sieht, damit beschäftigt, irgendeiner Situation beizuwohnen. Das waren oft Festsituationen oder ein touristisches Ereignis, wie ein Wasserfall, und aus diesem Grund war es nicht fremd, dass da jemand mit einer Kamera war; das heißt, ich bin nicht als Störenfried aufgefallen. Die haben sich nur gewundert, dass ich die Kamera in die falsche Richtung gehalten habe! (Beide lachen.)
EGC: Das war das Einzige, was sie irritierte?
HB: Ja. Und natürlich, wenn ich einmal geblitzt hatte, dann haben die Leute immer wieder in die Kamera geguckt, und das wollte ich nicht.
EGC: Ja, da war’s dann wohl auch vorbei. – Und die Entwicklung, das Material und das Labor, das war alles vor Ort?
HB: Ich habe die Sachen selbst entwickelt, das war alles schwarz-weiß, ich habe das selbst entwickelt und vergrößert.
EGC: Bei Dir zuhause?
HB: Ja, ich habe ein Fotolabor gehabt, das damals schon auf einem sehr professionellen Stand war.
EGC: Und auf welchen Papieren hast Du die Arbeiten abgezogen, kannst Du Dich noch erinnern?
HB: Ja, klar, das war ein Chlor-Brom-Silberpapier von Agfa, das hieß »Record Rapid«, es wird inzwischen nicht mehr produziert. Das ist ein warmtoniges Baryth-Papier, und ich habe einen sehr, sehr großen Wert auf die Qualität der Prints gelegt. Ich habe, was relativ ungewöhnlich ist, mit einer Drei-Schalen-Entwicklung gearbeitet. Das heißt, es gab einen weichen, einen normalen und einen harten Entwickler, und dann Stoppbad und Fixierbad. Und ich habe zwischen diesen Entwicklern mit dem Print immer hin und her jongliert, habe dann teilweise, zum Beispiel eine Gesichtspartie, nur mit einem Kleenex und mit einem weichen Entwickler noch mal anders behandelt als die Umgebung. Besonders schwierig war es, weil ich mit Blitz gearbeitet habe. Es gab ein großes Lichtgefälle, was ich durch Abwedeln und Nachbelichten wieder ausgeglichen habe. Deswegen ist es überhaupt ziemlich schwierig, diese Fotos zu printen. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass das jemand anderes dann so hinkriegen würde. Es ist anders, als wenn man ganz normal bei Tageslicht fotografiert. So ein Print hat mindestens ein- bis eineinhalb Stunden gedauert, bis er fertig war. Deswegen gibt es auch nicht so viele.
EGC: Und wo befinden sich die Fotos heute?
HB: Die Fotos sind weitgehend in meinem Besitz. Es gibt aber einen kompletten Satz, der sich im Moment an der Kunsthalle Mannheim befindet, den ich da für eine Ausstellung ausgeliehen habe. Die Fotos wurden damals teilweise verkauft. Im Moment habe ich mitbekommen, dass in München im Haus der Kunst gerade ein Bild in einer Ausstellung zu sehen ist, nämlich aus der Sammlung von Martin Parr, ein Fotograf, der sehr, sehr früh eins dieser Bilder erworben hat.
EGC: Ich habe die Ausstellung gesehen und auch das Foto. Es ist sehr interessant.
HB: Und der hat das damals in Belgien in einer Galerie gekauft, worauf ich sehr, sehr stolz bin, und dass er das ganz schnell gecheckt hat.
EGC: Hast Du zu dieser Zeit nur an der Menschen-Serie gearbeitet?
HB: Noch während ich an dieser Serie gearbeitet habe, habe ich ein anderes Projekt angefangen. Das war relativ radikal, ich wurde damals von meinem Professor an der Hochschule Kassel dafür beschimpft, dass ich so etwas mache. Und zwar ging es darum, aus Büchern Fotos zu machen, mit Strichfilm, das heißt ganz hart: nur schwarz und weiß. Ich habe aus Büchern ganz einfache, relativ unkünstlerische Schwarz-Weiß-Illustrationen, meistens waren das so eine Art Strichmännchen, heraus fotografiert oder manchmal auch nur Textpassagen oder Kombinationen von einfachen Figuren mit Texten und diese auf ein Fotopapier in 30 x 40 ausgeprintet. Das waren dann meistens Serien. Die heißen zum Beispiel Die Milch ist gut oder Men are persons. Die Serien waren immer relativ klein, so ein, zwei, drei Bilder, aber es gab auch größere Konvolute, wie die, die ich eben erwähnt habe. Diese Blätter sind insofern irritierend, weil man denkt, dass es so was wie eine Fotokopie sei. Heute könnte man sie für einen Computerausdruck halten, das gab’s damals aber noch nicht. Mir war wichtig zu behaupten, dass es da um Fotografie geht, und das hat die Leute zu dieser Zeit einigermaßen verwirrt. Weil man eben Zeichnungen zu sehen glaubte oder Text, und keine Fotos.
EGC: Und die Fotografien hast Du in der gleichen Art wie die Menschen gemacht?
HB: Genau. In dieselbe Größe vergrößert. Komischerweise war das für mich nicht so ein Riesenunterschied. Ich habe bei der Serie Menschen diese aus ihrer Umgebung herausgelöst und dann in einem abstrahierten Kontext eingeführt. Dasselbe habe ich mit diesen nachfolgenden Illustrationen und Texten gemacht. Für mich war das gar nicht so verschieden von der Vorgehensweise her. Vom Sujet natürlich schon, ja, aber es hat doch für große Verwirrung gesorgt.
EGC: Und wer war Dein Professor zu der Zeit?
HB: Günter Rambow. Er hat mich mit allem bekannt gemacht, was in der Fotografie wichtig war.
EGC: Günther Rambow?
HB: Ja, ein Grafiker, der sich viel mit Fotografie beschäftigt.



EGC: Jetzt kommen wir zu den Reproduktionen.
HB: Ja, die Repro-Bilder sind die Werkgruppe, von der Du auch ein Bild hast!
EGC: Vice.
HB: Ja, genau. – Es war dann so, dass ich eine zweite Serie von Reproduktionen angefangen habe, die ich Repro-Bilder genannt habe. Ich habe sehr viele Zeitungsausschnitte gesammelt, Fotoausschnitte aus Büchern, und habe dann mit diesen Fotos Arrangements gemacht, sehr einfache Diptychen, Tryptichen, teilweise habe ich sie gespiegelt angeordnet, und diese Bilder habe ich sehr vergrößert.
Meistens gibt’s eine Grundseite von mindestens einem Meter Länge, teilweise sind sie auch bis zu vier Meter breit. Das war dann noch mal ein Sprung, weil diese Arbeiten weniger als Fotografien wirkten – durch die schwarze Rahmung hatten sie eigentlich einen sehr bildhaften Charakter und haben sich natürlich auf Arbeiten von Sigmar Polke oder Pop Art bezogen.
EGC: Aber sie sind dann auch auf einem anderen Papier abgezogen worden?
HB: Genau. Ich habe sie damals selber geprintet. Ich habe mir extra aus Abflussrohren Entwicklungswannen bauen lassen, und es war so, dass praktisch ein Foto nach der Belichtung zusammengerollt wurde, dann wurde es in eine dieser Wanne reingelegt und neu aufgewickelt, so dass praktisch immer ein Teil durch den Entwickler oder das Stoppbad oder das Fix ging, und dann habe ich die immer hin und her gewickelt und schließlich in einem großen Becken gewässert. Dann wurden die Prints nass auf mit Dachlatten verstärkte Melamin-Platten aufgezogen und an den Rändern angetackert.
EGC: Also nicht geklebt?
HB: Doch, doch. Mit Planatol habe ich die aufgeklebt! Und die Melamin-Platten habe ich vorher leicht angeraut. Die Bilder wurden teilweise auch danach mit Farmerschem Abschwächer nachbehandelt.
EGC: Was ist das?
HB: Farmerscher Abschwächer – damit kann man Grauschleier 'rausätzen. Die Chemikalie habe ich auch für die Prints von den Menschen verwendet. Die habe ich generell eher ein bisschen grau geprintet und hinterher die Highlights mit Farmerschem Abschwächer rausgeholt.
EGC: Und wie muss man sich das vorstellen? Ist das auf der Platte oder hast Du das im aufgezogenen Zustand bearbeitet?
HB: Nein, das ist so, dass man das Bild schon getrocknet hat; besser funktioniert es, wenn man es leicht anfeuchtet, weil der Farmersche Abschwächer ein Salz ist, das mit Wasser aufgelöst wird. Und je nach Größe habe ich es mit ’nem Marderhaarpinsel oder mit Kleenex aufgetragen. Man muss sehr schnell sein, weil das sehr rasch reagiert mit der Fotoschicht, und wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, muss man es sofort ins Fixierbad tun, dann wird der Prozess gestoppt. Danach fixiert und wässert man’s noch mal.
EGC: Ich habe noch eine Frage zu den Rahmen. Die Rahmen, die waren so ziemlich rohe Leisten?
HB: Genau, das waren Kiefernleisten, die gehobelt waren, also ein bisschen besser als Dachlatten. Die habe ich dann mit einer schwarzen Wand- oder Acrylfarbe mit dem Pinsel bemalt. Die wurden dann einfach einmal drum rum gehauen – fertig!
EGC: Plakafarben hast Du also nicht verwendet?
HB: In dem Fall nicht. – Es gab vielleicht noch, ja, das ist auch noch wichtig zu wissen, natürlich Retuschen, und die Retuschen habe ich ganz klassisch mit Eiweißlasurfarbe gemacht.
EGC: Jetzt kommen wir zu den Porträts von 1981-1988, 31 Fotos, Chrom-Silber-Fotografien, aufgezogen auf Melamin bzw. Alubond, gerahmt. Ziemlich groß: je 225 x 113 cm. Welcher Bildquellen hast Du Dich hier bedient?
HB: Zu der Zeit hatte ich schon ein relativ umfangreiches Archiv angelegt. Das habe ich so Anfang der achtziger Jahre begonnen, und ich habe aus diesem Archiv Porträtfotos herausgefiltert. Teilweise waren es gar keine reinen Porträtfotos, sondern Bilder, die aus irgendwelchen komplexeren Szenen stammten. Es ging relativ oft um gewalttätige Momente. Teilweise waren die Emotionen, die man da spürt auf den Bildern, echt, und teilweise waren sie von Schauspielern dargestellt. Das hat sich aber für den Betrachter so vermischt, dass man eigentlich nicht mehr richtig wusste, woran man ist.
Was mich sehr interessiert hat, war ein Moment, das natürlich jeder kennt, dass es ein Unterschied ist, ob man einen Menschen mit Namen kennt oder ob er anonym ist. Was sich durch einen Namen in Verbindung mit einem Porträt verändert, habe ich versucht, in dieser Serie auszuloten. Interessant ist vielleicht auch das Maß: 2,25 m. Ich habe mir, bevor ich angefangen habe, Anfang der achtziger Jahre, große Arbeiten zu machen, sehr intensiv überlegt, welche Größen man denn nimmt. Ich war da relativ unerfahren, ich habe ja Fotografie studiert und nicht Malerei und wollte ursprünglich auch gar kein Künstler werden und habe mich dann für mehrere Maße entschieden, die ich heute auch noch verwende: Das eine ist ein Meter, weil das so ein Normmaß ist, auch das Vice-Bild in Deiner Sammlung ist ein Meter auf ein Meter. Das nächste Maß war 1,79 m, das ist meine Körpergröße, und 2,25 m ist die Größe meines Körpers, wenn ich die Hände nach oben strecke. Mit diesen drei Maßen habe ich immer wieder sehr stark gearbeitet, weil ich sie verbindlich fand.
EGC: Und das gilt heute noch?
HB: Das gilt für viele Arbeiten, die ich heute mache, noch genauso.
EGC: Das ist sehr interessant. – Zum technischen Vorgehen: Kannst Du den Entstehungsprozess der Arbeiten beschreiben?
HB: Die Reproduktion für die Porträts habe ich mit einer Mittelformatkamera gemacht, dann habe ich das Foto nochmals geprintet auf Baryth-Papier und habe es beim Printen optimiert. Dieses Bild habe ich noch mal reproduziert und habe einen Strichfilm produziert, das heißt einen durchsichtigen Film, auf dem ganz schwarz diese Schrift enthalten war. Diese beiden Negative habe ich übereinandergelegt und zusammen vergrößert, so dass sich diese weiße Schrift ergeben hat. Das kann man aber mit einem Graustufenpapier nicht hundertprozentig präzise hinkriegen. Es gab dann an diesen Rändern von den Schriften immer wieder so leichte Überstrahlungen, weil ich die sehr scharf haben wollte, habe ich auch die mir Farmerschem Abschwächer nachbehandelt.
EGC: Und was für Papier war das jetzt?
HB: Das war dasselbe Papier wie für die Repro-Bilder. Das hat damals die Firma Tura produziert. Das war ein sehr mattes Papier, das fast wie so ein Werkdruckpapier wirkte. Und es hatte nicht diesen glänzenden, speckigen Charakter wie die ganzen anderen Fotopapiere, die es damals gab.
EGC: Das war während dem ganzen Behandlungs- und Entwicklungsprozess auch sehr fragil?
HB: Nein, das war ein sehr robustes Papier, und man konnte da eigentlich sehr derb mit umgehen. Es hatte einen unglaublich schönen matten Charakter. Ich habe das dann auch noch eine Zeit lang gebunkert, um möglichst lange damit arbeiten zu können. Mittlerweile ist es vom Markt verschwunden. Das gibt’s nicht mehr.
EGC: Wie wurden die Fotos aufgezogen und mit welchem Klebemittel? Auch wieder mit Planatol?
HB: Genau! Das war im Grunde genommen wieder dieselbe Technik, die ich vorhin auch beschrieben habe. Da wurde eine Melanin-Platte, angeschliffen, Dachlatten dahinter, und dann kam ein schwarzer Rahmen dazu. Was mich irgendwie sehr genervt hat, ich war da technisch auch noch nicht sehr erfahren: Diese Dachlatten waren oft relativ frisch und haben sich dann im Laufe der Zeit zusammengezogen, so dass die Bilder dann manchmal einen Bauch bekommen haben.
EGC: Durch die Spannung?
HB: Durch die Spannung, und ich habe das dann bei diesen Bildern und auch bei den Repro-Bildern manchmal versucht, auszugleichen, indem ich hintendran noch eine Metallarmierung gesetzt habe, um das wieder weg zu biegen. Es war in meinen Augen, im Nachhinein, nicht optimal, lag aber auch einfach daran, dass für aufwändigere Techniken das Geld nicht da war.
EGC: Hast Du irgendwelche negativen Veränderung feststellen können durch die Verwendung des Planatols im Papier oder so?
HB: Also, von dem Planatol habe ich nichts Negatives mitbekommen, aber dadurch, dass ich die Sachen per Hand entwickelt habe und hinterher mit diesem Farmerschen Abschwächer noch mal draufgegangen bin, gibt es einige von diesen Bildern, die manchmal gelbe Stellen haben. Und das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. Ich habe damals alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, bei manchen Bildern ist das aufgetreten. Aber es ist relativ selten.
EGC: Einige dieser Bilder hast Du auf Aluminiumplattenmaterial aufgezogen. Um was für ein Aluminium geht es da? Ist es ein Alu-Dibond?
HB: Das war Alucobond. Später, als ich ein bisschen mehr Geld für die Produktion einsetzen konnte, habe ich es so gemacht: Ich habe mir Alucobond-Platten besorgt, habe hinten auf das Alucobond noch mal einen Rahmen aus Aluminiumvierkantprofilen gesetzt zur Verstärkung, habe dann das Alucobond angeschliffen und die nassen Fotos darüber gezogen, auch mit Planatol.
EGC: Du hast nie Ponal verwendet?
HB: Also, vielleicht mal für das erste oder so.
EGC: Oder im Holzbereich?
HB: Im Holzbereich auf jeden Fall. – Ich hatte mich irgendwann Mal erkundigt, was ein guter, verträglicher Leim ist und bin dann bei Planatol gelandet. Und das habe ich auch verwendet für diese Aluminiumgeschichte. Dadurch, dass das Alucobond so einen weichen Kern hat, habe ich die Bilder nass drübergezogen und habe das seitlich eingetackert und habe dann da eben auch wieder diesen schwarzen Rahmen drum rum gemacht.
EGC: Zusätzlich zur Verklebung hast Du da an der Spannkante getackert?
HB: Genau! Also, die Fotos sind ziemlich gespannt aufgebracht worden, in dieser Länge von 2,25 m, schätze ich mal, dass das Foto dann auch einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter größer war, als im getrockneten Zustand. Es ist dann auch immer von dem Bild ein bisschen was an der Kante verschwunden.
EGC: Sehr interessant. Und die Rahmen und die Farben, mit denen Du sie gefasst hast, sind die gleichen wie oben?
HB: Ja.
EGC: Jetzt zu den Projektionen und Lichtinstallationen, 1987 bis 1988 Time im Besitz des Museums für Moderne Kunst in Frankfurt: Version A, Offset-Drucke, Karton und Leinwand, je 5 x 16,5 cm im Karteikasten (8,5 x 18,5 x 56,5 cm); Version B, Endlosprojektion für zwei Karusselprojektoren mit Überblendeinheit.
HB: Die Arbeit Time entstand auch aus meinem Fotoarchiv heraus. Ich hatte damals ein großes Konvolut an Time Magazine bekommen aus den 70er Jahren und habe aus den Titelbildern dieser Hefte eine Auswahl getroffen. Und zwar ging es mir nur um diesen Schriftzug »Time«, der -eben immer in derselben Typografie war. Mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Der war stets in einer anderen Farbe und außen rum sah man immer einen Teil des Titelfotos. Aber eher einen unwesentlichen Teil, der von diesem Schriftzug überdeckt war. Ich habe eine Auswahl getroffen von 162 Bildern; das entspricht der Füllung zweier Karusselmagazine, und habe dann die Originalzeitungsausschnitte auf einen säurefreien Karton aufgezogen, den ich mit Aluminium hinterlegt habe. Das Ganze habe ich in einen Karteikasten gegeben – das ist der eine Teil der Arbeit. Aber der wesentliche Teil, auf den es mir ankommt, waren dann Reproduktionen auf Kleinbild-Diafilm von diesen Ausschnitten, die mit zwei Projektoren in einer endlosen Überblendung dann nacheinander durchlaufen.
Was man da technisch noch wissen muss, ist, dass es ein Problem gibt, wenn man ein normales Dia hat, das eine maximale Schwärzung hat. Wenn man das projiziert, ist an der Stelle der Schwärzung immer noch ein Grauton auf der Wand durch den Licht trifft. Aus diesem Grund habe ich für jedes Dia mit Strichfilm eine Maske gemacht und im Sandwich drüber gelegt. Das heißt, in einem Diarahmen befindet sich das Dia und die Maske, so dass man außen rum eben kein graues Feld sieht, man hat dann nur ganz pur diesen Time-Schriftzug.
EGC: Ist aber unglaublich aufwändig.
HB: Naja, ist halt Arbeit, ganz normal.
EGC: Und wer hat die Offset-Drucke angefertigt? Die Druckerei?
HB: Nein, die Offset-Drucke waren die Originaldrucke aus dem »Time«-Magazin. Das ist praktisch das Originalmaterial.
EGC: Jetzt habe ich noch eine Frage generell zu den Dias, die bei den Projektionen verwendet wurden. Mit welchen Diafilmen hast Du gearbeitet?
HB: Ich habe natürlich einen möglichst feinkörnigen Diafilm genommen, einen, der von sich aus nicht die Farbinformation noch mal manipuliert. Ich geh' mal davon aus, dass das in dem Fall ein Kodak-Ektachrome-Film war.
EGC: Hast Du Farbveränderungen während der Ausstellungszeit bei dieser Projektionsarbeit feststellen können?
HB: Nein. Die Arbeit gehört dem MMK und ist ab und zu mal zu sehen gewesen, aber jetzt auch nicht so intensiv, dass man sich Sorgen machen müsste. Es ist so, dass diese Idee, die Karteikasten mit den Originalen zu machen, vor dem Hintergrund entstanden ist, dass ich gedacht habe: Okay, wenn die Dias kaputtgehen, das kann ja sein, dass so ein Gerät mal stehen bleibt und das Dia dann verschmort oder irgendein Besucher nimmt so ’n Teil mit, dann kann man sie immer wieder reproduzieren.
EGC: Aber Du selber hast nie diese Arbeit reproduziert?
HB: Außer einmal, nein.
EGC: Einmal, ja, und dann hast Du’s ans MMK gegeben.
HB: Für diese Fassung. Es gibt da keine zweite Version. Ich bin aber gerade am überlegen, ob es sinnvoll wäre, meine ganzen Projektionsarbeiten zu digitalisieren...
EGC: Jetzt kommen wir zu Augentauschen aus den Jahren 1987 bis 1993. Wie entstand diese Arbeit?
HB: Die Arbeit entstand wiederum auch aus meinem Archiv heraus. Ich habe damals ein Stipendium bekommen vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), das damals gerade in Karlsruhe auf den Weg gebracht wurde. Das war eine relativ aufwändige Produktion. Ich habe dafür auch noch zusätzliches Fotomaterial ganz gezielt gesucht. Die Arbeit besteht aus zwei Bildern, die an der Wand projiziert werden, zwei Kreise, die wie zwei Augen wirken, die einen angucken, und man sieht im Grunde genommen nur Gesichtsausschnitte von Menschen. Das Ganze wird gespeist von zwei mal zwei Diaprojektoren und einer Überblendeinheit. Die Bilder werden kontinuierlich als Loop ineinander geblendet. Unterbrochen werden die Gesichter durch verschiedene andere atmosphärische Bilder. Es geht um ein Lexikon menschlicher Emotionen, bei dem ich versucht habe, jede Emotion, im positiven wie im negativen Sinne, die man über ein Gesicht wahrnehmen kann, darzustellen. Augentauschen ist ein Kompendium menschlicher Gesichtsausdrücke.
EGC: Und die Arbeit gehört dem ZKM oder ist sie in Deinem Besitz?
HB: Die ist in meinem Besitz. Aber sie ist im Rahmen vom ZKM relativ oft gezeigt worden.
EGC: Nun zu den Bildtafeln Wollheim-Memorial auf dem Campus der Universität Frankfurt IG Farben Haus.
HB: Das ist jetzt eine ganz aktuelle Arbeit, eben auch mit Fotografie. Sie besteht, ähnlich wie die Porträts, aus der Verbindung einer typografischen Information mit einem Foto. Diese Bilder sind öffentlich in einem Park des ehemaligen IG Farben Geländes in Frankfurt aufgestellt und aufgrund dessen, dass sie draußen stehen und man mit Vandalismus rechnen muss, habe ich da eine spezielle Technik entwickelt.
Es handelt sich um Familienbilder, die in der Regel einen sehr intimen Charakter haben, aus der Zeit vor der Nazi-Herrschaft. Man sieht auf diesen Bildern Menschen, die später ins KZ Buna-Monowitz verbracht wurden, das die IG Farben in der Nähe von Auschwitz unterhielten. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Bilder eine sehr positive, glücksversprechende Ausstrahlung haben, dieses vermeintliche Glück wird konfrontiert mit einer eingravierten Zahl – der späteren Häftlingsnummer des Abgebildeten. Technisch ist das so gemacht, dass wir diese Bilder zunächst am Computer nachbearbeiten und dann in einem relativ aufwändigen Verfahren rastern. Dann wird daraus eine 3D-Datei gebaut, die dann von einer Computerfräse umgesetzt wird. Die Computerfräse bringt praktisch das Bild in eine 30 Millimeter Aluminiumplatte ein. Die Rasterpunkte bleiben auf der Oberfläche stehen und der Rest wird weggefräst.
Dann wird ein Primer aufgetragen mit Zweikomponentenfarbe und dann noch mal ein Anti-Graffiti-Schutz darüber lackiert. Die Idee ist, dass, wenn so ein Bild durch ’ne Sprühdose oder so zerstört wird, dass man dann die Farbe komplett ablösen und sie wieder neu darüber walzen kann, weil durch die hervorstehenden Bildpunkte die ganze Information eben noch da ist.
EGC: Und wer führt diese Fräsungen aus?
HB: Da arbeiten verschiedene Leute mit; ich habe einen Assistenten hier bei mir im Atelier, Jan Lotter, der für die Umsetzung vom Graustufenbild ins Rasterbild ungefähr zwei bis drei Tage einsetzt. Wir drucken das dann immer eins zu eins aus und stimmen das aufeinander ab. Dann wird das Ganze über eine Software in ein 3D-Programm gebracht. Das sind wesentlich größere Dateien, die dann von einer Firma im Rheinland in einem zweiwöchigen Fräsverfahren in diese Platte eingraviert werden. Danach wird das Ganze noch mal eloxiert.
EGC: Das heißt, jedes einzelne Motiv braucht zwei Wochen, bis das Bild durch die Fräsung entsteht.
HB: Genau.
EGC: Und was für ’ne Aluminiumsorte ist das?
HB: Das ist ALGM3 und das wird hinterher dann noch mal mit einer Eloxierung gehärtet. Ursprünglich hatte ich die naive Idee, dass man das ja auch mit V2A Platten machen könnte, nur kommt da halt auch keine Fräse mehr durch. Also, man muss da so einen Mittelweg finden, dass eben normale Fräsköpfe in einer annehmbaren Geschwindigkeit das Material beherrschen können und nicht dauernd abbrechen. Das war das Beste, was wir finden konnten.
EGC: Welche Software-Programme werden hierfür verwendet?
HB: Für die Umsetzung in diese Rasterdateien ist es Photoshop und Illustrator. Die 3D Software ist eine Spezialsoftware, die zur Computerfräse gehört. Das ist so eine CNC-Spezialgeschichte, die kann man jetzt als normaler User mit einem Grafikprogramm auch gar nicht beherrschen.
EGC: Und die Tafeln, habe ich bei Deinen Mustern gesehen, haben abgewinkelte Beine?
HB: Genau.
EGC: Ist das dafür, dass sie in Beton eingesetzt werden?
HB: Es ist so, dass wir diese Platten innerhalb von Baumgruppen aufstellen im IG Farben Gelände, da mussten wir relativ vorsichtig sein, weil das ganz alte Bäume sind, die flach wurzeln. Wir machen da ein Beton-Fundament, in der Größe eines Eimers, darauf kommt eine verdeckte Metallbodenplatte. Aus der kommen zwei Profile raus, und da wird eben dann das Standprofil draufgesetzt mit dem Foto. Und das Foto steht so ein bisschen schräg.
EGC: Nach hinten?
HB: Nach hinten weg.
EGC: Dadurch erklärt sich diese Neigung in den beiden Beinen.
HB: Genau.




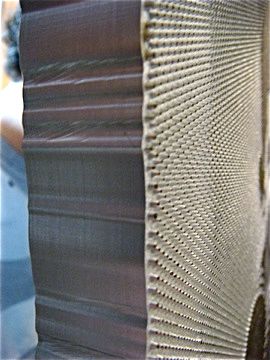
EGC: Heiner, jetzt zu Deinem Projekt Schmalclub!
HB: Es ist so, dass ich als Künstler nicht nur im klassischen White-Cube-Bereich arbeite, sondern auch ein sehr starkes Interesse habe an sozialen Räumen, an Momenten und Situationen. Von 2000 bis 2003 war ich künstlerischer Leiter eines Projekts namens Schmalclub. Es fand am Theater am Turm statt, unter der Ägide von William Forsythe, und ich habe da mit Studierenden von der Hochschule für Gestaltung fast 25 Abende gestaltet, die für die Besucher immer eine komplette Überraschung waren. Es war kein Theater, es war keine Performance, es war kein Kino, es war kein Film, es war kein normaler Club; wir haben uns praktisch die ganzen klassischen Vorgehensweisen verboten und haben das gemacht, was übrigblieb.
Jeder Club war eine Überraschung. Das Ganze hat relativ schnell Kultcharakter bekommen. Die Besucher waren keine Konsumenten, sondern haben bei uns einen aktiven Teil ihres Lebens verbracht. Wenn man heute Leute trifft, die da dabei waren, erzählen sie davon wie von einem ganz tollen Urlaub oder einem Schlüsselerlebnis.
Diese Geschichte ist vergangen, man kann sie nicht als Bild an die Wand hängen oder als Skulptur auf einen Sockel stellen. Es ist ganz bewusst ein Projekt gewesen, das auf den Moment abgezielt hat und auf das Unwiederbringliche, die eben schöne Momente haben. Es gibt davon von verschiedenen Fotografen, die für uns gearbeitet haben, eine sehr schöne Fotodokumentation. Diese Fotodokumentation ist aber nicht als Kunstwerk zu sehen. Wir haben vor Kurzem bei einer Ausstellung im ZKM mal eine Art Dokuwand gemacht, aber das sehe ich vollkommen anders, als die fotografischen Arbeiten, über die wir vorher gesprochen haben. Der Schmalclub kann auf der Basis dieser Fotos zu jeder Zeit als Dokumentation in einem Buch oder an einer Wand gezeigt werden. Damit kann es einen relativ offenen Umgang geben. Diese Fotos sind aber nicht als Kunstwerke gedacht – ich glaube, das gibt es manchmal bei Performances, dass man die Doku dann später in einer bestimmten Auflage printet, unterschreibt, einrahmt und so weiter. Ganz bewusst sind das keine Artefakte, sie sollen nur auf etwas verweisen, was vergangen ist.




EGC: Nun zur Arbeit Alarm.
HB: Alarm war im Grunde genommen mein Ausstieg aus der Fotografie und mein Einstieg in die Kunst. Ich habe ja in Kassel Fotografie studiert und wollte ursprünglich auch Bildjournalist werden. Von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre habe ich mein Geld mit Fotografieren verdient und habe damit meine künstlerischen Projekte finanziert. Die Alarm-Serie entstand auf der Basis von Boulevardzeitschriften, und zwar hatte ich festgestellt, dass diese Zeitschriften sehr emotional ihre Kunden antriggern, und es war zu der Zeit üblich, eine Hauptmeldung bei der Bildzeitung, aber auch bei anderen Zeitungen wie zum Beispiel Express oder ich glaube, Münchner Abendzeitung war auch mit dabei, in einen schwarzen Block zu setzten, mit weißer Schrift. Ich habe diese schwarzen Blöcke herausgeschnitten, die Formen waren geometrisch, viele erinnerten mich an architektonische Grundrisse. Ich habe die schwarzen Blöcke rausgeschnitten, habe sie fotokopiert, die Fotokopien geschwärzt und dann auf weiße Papiere aufgeklebt. Die eigentliche Arbeit war das geschwärzte Bild mit einem freigelassenen Text und das andere unbehandelte war das Archivbild. Von der Technik her waren das normale Fotokopien, ich habe sie mit Gouache übermalt und dann mit dem blauen 3M Sprühkleber auf ein Papier aufgeklebt. Darunter habe ich mit Bleistift eine Notiz gemacht: Quelle und Datum. Dieses Konvolut ist Anfang der 80er Jahre entstanden, es sind ungefähr 200 Blätter. Nachdem sich lange Zeit niemand dafür interessiert hatte, kam Jean-Christophe Ammann bei mir im Atelier vorbei, und hat den ganzen Block auf einmal fürs MMK gekauft. Darüber bin ich auch ganz glücklich, dass die zusammengeblieben sind.
EGC: Auf welchem Papier sind die aufgelegt? Kannst Du Dich noch an die Papierqualität erinnern?
HB: Ich glaube, ich habe einfaches Offset Papier benutzt. Ich habe mich damals nicht großartig erkundigt, ich hatte kaum Geld zu dieser Zeit. Wir haben dann, als die Blätter ins MMK gegangen sind, mit einer Papierrestauratorin zusammen einen Teil der Blätter ausgetauscht, die verknickt waren.
EGC: Und die sind hinter Passepartouts gelegt?
HB: Nein, wir haben die freihängend gerahmt, so dass die nicht das Glas berühren.
EGC: Okay, mit einer Abstandsleiste?
HB: Ganz genau.
EGC: Das war die Frau Noehles gewesen?
HB: Hier in Mühlheim.
EGC: Jetzt kommen wir zu den Passepartout-Bildern.
HB: Die Passepartout-Bilder sind Mitte der 80er Jahre entstanden. Das ist eine sehr große Anzahl von Arbeiten. Es ging darum, mit Hilfe eines Passepartouts ein gefundenes Bild, meistens aus einem journalistischen oder aus einem werblichen Zusammenhang zu überdecken und nur einen Ausschnitt zu präsentieren. Die Ergebnisse sahen so aus, als hätte ich diese Bilder selbst erzeugt oder als hätte ich selbst Text-Bildkombinationen hergestellt. Ich habe aber praktisch diesen Bildern nichts hinzugefügt, es ging nur darum, einen bestimmten Ausschnitt zu definieren. Die Passepartout-Bilder sind alle Unikate, die gibt es teilweise als einzelne Arbeit, teilweise gibt’s aber auch Serien wie Men on the spot, Poems oder die Johnnie Walker-Bilder, die dann in die Sammlung Speck gelangt sind.
EGC: Und das sind auch Offset-Drucke?
HB: Das sind praktisch ganz normale Ausschnitte aus Zeitschriften.
EGC: Also die Zeitungsoffset-Drucke?
HB: Ja, genau, und die Hauptquellen damals waren das »Time«-Magazin, (lacht) das habe ich im Grunde genommen doppelt verwertet: das Cover für die »Time«-Arbeit und dann den Innenteil für die Passepartout-Bilder. Eine andere wichtige Quelle war die englische Wirtschaftszeitschrift »Economist«.
EGC: Jetzt kommen wir zu den Shaped Canvas-Bildern.
HB: Die Shaped Canvas Bildern habe ich Anfang der 80er Jahre begonnen, nach der Alarm-Serie, und zwar war da die Idee, die Motive der Alarm-Serie, also diese geometrischen Formen, zu vergrößern und in Proportion zu meinen Körpermaßen zu bringen. Ich habe mich da, weil ich relativ unerfahren war, mit einem Freund, der Maler war, beratschlagt, wie man das am besten technisch realisieren könnte. Die Art, wie ich die Arbeiten dann gebaut habe, ist nicht wirklich optimal. Die ersten dieser Bilder waren vom Aufbau her so, dass ich gehobelte Dachlatten genommen habe, um daraus eine Rahmenkonstruktion zu bauen, die ich dann mit einem relativ hochqualitativen Nesselstoff überzogen habe. Dann hatte ich mir eine Spritzpistole gekauft, aber so eine ganz billige Heimwerkerspritzpistole, ohne großen Kompressor. Damit habe dann mit einem handelsüblichen, schwarzen Acryllack zunächst eine schwarze Fläche erzeugt. Diese war dann relativ glatt und hatte so einen leichten Glanz. Dann habe ich eine Schablone aufgebracht, die Schrift darauf projiziert, dann die Buchstaben mit dem Messer ausgeschnitten und schließlich einen weißen Lack auch mit einer Spritzpistole aufgetragen. Es gab dann noch mal einen Arbeitsschritt, bei dem alles, was unter der Schablone durchgelaufen war, wieder nachgeschwärzt werden musste. Im Lauf der Zeit habe ich dann besser kapiert, wie man das macht, und habe das weiter professionalisiert.
Das Problem bei diesen Bildern ist, dass man sie nicht im Keilrahmen nachspannen kann. Ich habe jetzt im Moment einen Teil von diesen Bildern in der Kunsthalle in Mannheim als Leihgabe. Und da sie, wie soll ich sagen, an manchen Stellen ein bisschen schlapp geworden sind, habe ich, das wirst Du mir hoffentlich als Restaurator verzeihen, hinten, praktisch über die Gesamtfläche, Styroporplatten reingemacht und das Styropor ein bisschen nach vorne gedrückt, so dass von vorne gesehen diese Fläche relativ prall aussieht.
EGC: Also praktisch wie ein Spannungspolster?
HB: Genau. – Was Besseres ist mir da nicht eingefallen; weil die Bilder über den Rand hinaus bemalt sind, wäre das eine riesige Operation, sie nachzuspannen, und würde wahrscheinlich zu anderen Schäden führen. Nachdem ich damit unzufrieden war, habe ich was Anderes probiert: Ich habe mit Dachlatten einen Rahmen gebaut und darauf eine Hartfaserplatte aufgebracht, dann darüber wiederum Leinwand geleimt und das Ganze schließlich bemalt. Zudem gibt es noch eine Variante, die ich relativ massiv aus MDF gebaut habe, mit einem Schreiner zusammen. Da ich mit Acrylfarbe gearbeitet habe, hat das aber dazu geführt, dass sich diese Bilder ein bisschen verzogen haben. Ich habe deswegen Armierungen hinten aufgeschraubt. Diese ganze Phase mit den vergrößerten Alarm-Bildern war ein Experiment, bei dem ich eigentlich bis zum Schluss nicht die wirklich richtige Technik gefunden habe – was aber letztlich auch wieder im Kern ein Geldproblem war. Ich bin dann von den handelsüblichen Farben, das waren ursprünglich Bondex Acryllacke für Heimwerker, relativ bald umgestiegen auf Acryl, das ich bei Dr. Kremer gekauft habe: Mowilit, kann das sein? Und es gab noch einen anderen Acrylbinder, ich habe mit einem matten und einem glänzenden gemalt. Dann habe ich gleichzeitig noch mit Caparol gearbeitet, das hat mir sehr gut gefallen, weil es sehr matt war. Diese Bindemittel wurden mit Pigmenten vermischt, bei Schwarz war das Pigment meiner Wahl Flammruß und bei Weiß war es Titanweiß.
EGC: Und Du hast die Pigmente auch bei Kremer gekauft?
HB: Ja. Genau.
EGC: Weißt Du noch, wie Du die geleimt hast, zum Beispiel die Leinwände auf die MDF-Platte?
HB: Ich fürchte, das habe ich mit Ponal gemacht.
EGC: Okay.
HB: (lacht)
EGC: Gut (lacht).
HB: Dann gab es im Farbauftrag verschiedene Varianten. Wie gesagt, ich hatte zuerst mit der Spritzpistole gearbeitet. Da gab es aber immer wieder Verstopfungen in der Düse, so dass es oft kleine Patzer auf der Fläche gab, die habe ich dann mit einem Stupspinsel ausgebessert. Auch die Schriften habe ich mit dem Stupspinsel aufgetragen. Das habe ich mir irgendwo bei einem alten Schildermaler abgeguckt. Dann hat sich das so verselbstständigt, dass ich eine ganze Reihe von Bildern komplett gestupst habe. Teilweise habe ich in die Acrylfarbe ein Mittel rein gegeben, das die Farbe dann so ein bisschen zäher gemacht hat, so dass durch das Stupsen eine Struktur entstanden ist.
EGC: Was für ein Mittel war das?
HB: Das war…, wie nennt man das? Verdicker!
EGC: Ein Acrylverdicker?
HB: Ein Acrylverdicker war das.
EGC: Auch von Kremer?
HB: Auch von Kremer, ich habe da ab und zu mal angerufen und mich von ihm beraten lassen. Die Bilder sehen im Nachhinein, finde ich, relativ bizarr aus. Das hat sich in irgendeiner Form verselbstständigt. Es gibt auch aus derselben Zeit, was mich immer so ein bisschen tröstet, Bilder von Peter Halley, der da auch teilweise Passagen seiner Malereien mit so einem Verdicker modelliert hat, aber aus heutiger Sicht sieht es für meinen Geschmack doch ein bisschen gruselig aus (lacht).
EGC: Dadurch ist eine besondere Handschrift entstanden. – Jetzt lass uns die weiteren Shaped Canvas-Bilder besprechen.
HB: Es gibt da eine Werkgruppe von Shaped Canvas-Bildern, die zur selben Zeit entstanden sind. Diese Bilder, von denen ich eben geredet habe, waren schwarze Bilder mit weißer Schrift, die bezogen sich auf die Alarm-Serie. Das waren zunächst Vergrößerungen der Alarm-Motive, aber nach ein, zwei Bildern war mir das zu langweilig, und ich habe dann selber Formen definiert und selbst auch eigene Texte hinzugefügt. Das erste Bild, das ich frei konstruiert habe, hieß Welt und sah aus wie ein großer Diarahmen.
EGC: Und wie kam es zu dem übermalten Logo einer Keksfirma?
HB: Dazu kommen wir jetzt. Parallel zu den Alarm-Arbeiten habe ich Logos gesammelt, die auf mich eine sehr starke geometrisch-archaische Wirkung hatten, bei denen ich das Gefühl hatte, sie repräsentieren jetzt nicht nur eine Firma wie De Beukelaer oder Biophar, sondern es entsteht in irgendeiner Form eine Kraft, die, sagen wir mal, einem Symbol entspricht, das auch aus einer archaischen Kultur kommen könnte. Diese Formen habe ich vergrößert nachgebaut, das war technisch ähnlich wie bei den anderen Shaped Canvas-Bildern; da gibt’s welche mit einer Rahmenkonstruktion, die mit Leinen überspannt ist, dann andere, die mit einer Hartfaserplatte versehen wurden, Leinwand drauf und dann die Farbe und eben noch mal die Variante praktisch komplett aus Sperrholz und dann mit Farbe behandelt. Sie sind alle monochrom. Zum einen gibt es eine Gitterstruktur, das damalige Logo von De Beukelaer, zum anderen drei rote Doppelkreuze, das war ein Motiv, das habe ich auf einem Honigglas gefunden. Ferner gab es »Drei blaue Gedanken«, das sind drei V-förmige Gebilde mit einem blauen Pigment bemalt, die Formen stammen von einem Verpackungskarton.
Und schließlich gab es noch so ein grünes, relativ schmales Kreuz, auch von einem Honigglas inspiriert.
Ich war damals bei der Konzeption dieser Arbeiten sehr stark von Palermo beeinflusst. Die Honigmotive waren sicherlich von meinen Besuchen in der Neuen Galerie in Kassel inspiriert: Hier habe ich mir immer wieder die zahlreichen Beuys-Arbeiten angeschaut. In der Folge habe ich dann einen größeren Block von Arbeiten hergestellt, die sich auf das christliche Logo, das Kreuz, beziehen. Die habe ich, Du hast es ja vorhin angesprochen, in Wiesbaden im Museum gezeigt. Von der Technik her war das alles entweder Acryl oder Dispersion, teilweise auch gemischt. Ich habe oft mit verschiedenen Schichten gearbeitet, die miteinander korrespondieren. Dieses grüne Kreuz zum Beispiel hat unten drunter eine dunklere Pigment-Schicht und dann ist da eine ziemlich matte, hellere Schicht darüber aufgetragen. Bei den roten Kreuzen ist es genau so: Da habe ich mit zwei verschiedenen Pigmenten gearbeitet, ich glaube, das eine hieß Studiorot, das andere Permanentrot, und die Hauptstruktur ist eben mit dem einen Pigment gemacht und dann kam praktisch noch eine ganz dünne Schicht mit dem anderen Pigment drüber. Die Kreuze sind alle weitgehend getupft, die oberste Schicht immer mit einem Naturschwamm.
EGC: Die Pigmente sind auch hier von Kremer gewesen?
HB: Genau. Sie sind alle von Kremer.
EGC: Jetzt kommen wir zu den Spielen. Wie ist die Serie entstanden?
HB: Von Beginn meiner künstlerischen Arbeit an habe ich immer eine sehr große Menge von Skizzen hergestellt, die aber nie als Zeichnungen gedacht waren, man könnte sie ausstellen, doch sie waren eher so ein Zwischenschritt. Zunächst gab es Skizzenbücher, in denen habe ich mir unterwegs Notizen gemacht. Auf der Basis dieser Skizzenbücher habe ich dann regelmäßig Din A4-Blätter angefertigt. Diese Din A4-Blätter sind so etwas wie Handlungsanweisungen, Ideen, Texte. Ich habe sie meistens einfach mit Bleistift ausgeführt, teilweise sind sie aquarelliert. Diese Skizzen habe ich fast automatisch hergestellt, so wie man Telefonzeichnungen macht, und habe dann immer beobachtet, was da so entsteht. Im Lauf der 80er Jahre entstand in diesem Kontext eine Serie von Wortspielen. Ich hatte bemerkt, dass es Worte gibt, in denen wiederum andere Worte enthalten sind. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und als ich Ende der 80er Jahre in Rom war, habe ich die endgültige Form dazu gefunden. Ich habe zuerst Pappmodelle gebaut, bei denen ich die Begriffe auf Schachteln geschrieben habe, die Wörter gingen dann um die Ecke, so dass, wenn man von links geguckt hat, sich ein Wort ergeben hat, von geradeaus drauf ein anderes und von der rechten Seite wieder ein anderes. Dann habe ich Proportionsmodelle gebaut und eine eigene Schrift für das Projekt entwickelt. Nach meiner Rückkehr begann die Produktion. Ich habe die Kästen von einer Schreinerei in Ginnheim bauen lassen, MDF, alles auf Gehrung geschnitten, geleimt, grundiert.
In meinem Atelier haben wir Schultafellack mit einem Velourroller auflackiert. Der Schultafellack war ein Gemisch von handelsüblichen Produkten. Es gab einmal von der Firma Glasurit eine Farbe, die sehr schön war, und dann eine Hausmarke von Farben Jenisch in Frankfurt, die hieß EinzA. Ich habe Schwarz- und Grüntöne miteinander vermischt, und es gibt verschiedene Serien, die immer einen anderen Schwarzgrünton haben. Nachdem der dunkle Schultafellack aufgetragen war, wurden die Kästen schabloniert. Ich habe die Buchstaben als Papierschablonen vorbereitet, die Texte wurden auf Airbrushfolie aufgezeichnet und dann wurden die Texte ausgeschnitten. Über die offene Schablone wurde zunächst die Grundfarbe gewalzt, um die Ränder zu schließen. Dann wurden in acht bis zehn Schichten chamois-farbener Kunstharzlack von Obi aufgetragen. Nach jeder Lackschicht wurden die Schriften nass geschliffen, mit einem ganz feinen Schleifpapier, und nach zehn Schichten blieb eine Art Schleiflackschicht übrig.
EGC: So ein ganz feines, flaches Reliefbild?
HB: Genau. Dann habe ich die Folie abgezogen, es wurde noch ein bisschen retuschiert, am Schluss habe ich eine Lösung angesetzt aus Kreide und Wasser und habe mit einem Schwamm aufgetragen, damit es auch diesen Schultafelcharakter bekommt.
EGC: So eine Art Patina?
HB: Ja, ja, es war mir sonst einfach zu hermetisch.
EGC: Und diese Wandboxen sind Unikate, keine Auflagenobjekte?
HB: Genau, es sind alles Unikate.



EGC: Nun zu einem Gegenstand bzw. Material, das uns von der Kindheit an begleitet hat und uns oft noch immer hilfreiche Dienste leistet: dem Radiergummi, den Du zu einem Zyklus umgearbeitet hast. Wie entstand die Idee und wie verlief die Entstehung dieser Objekte?
HB: Es gibt zwei verschiedene Radiergummi-Arten.
EGC: Es bezieht sich jetzt auf diese Läufer 1-3.
HB: Ja, genau. – Es gab eine Zeit, da habe ich mich sehr stark mit dem Phänomen der Zeit beschäftigt. Ich habe versucht, hierfür unterschiedlichste Visualisierungen zu finden. Zum Thema Lebenszeit habe ich eine Arbeit gemacht, die sah so aus, dass ich von den Händen meiner Mutter, von meinem Vater und meinen eigenen einen Silikonabdruck gemacht habe, und auf der Basis von diesen Händen habe ich Objekte erzeugt, die so aussahen, wie drei Arme mit je zwei Händen. Die Länge dieser Arme habe ich ins Verhältnis zur Lebenszeit gesetzt, und so ist eine Art statistische Wandskulptur entstanden. Mein Arm war dann am kürzesten, der von meiner Mutter entsprechend länger und der von meinem Vater noch länger.
Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, das Ganze in Radiergummi zu realisieren, und bin nach Hannover zur Firma Läufer gefahren und habe dort einen Techniker gefunden, der sehr hilfsbereit war, der mir aber gleich gesagt hat: Das wird nicht funktionieren. Ich war darauf drei Wochen in einer Produktionshalle und habe immer wieder neue Mischungen gemacht aus PVC-Radiergummi, bis ich es tatsächlich hinbekommen habe. Und diese Hände haben wir praktisch in einem Ofen über Nacht getempert, es wurde eine Masse in die Form hineingegeben, dann wurde die Form zusammengebunden mit Draht und blieb für 12-13 Stunden im Ofen. Es war ein großer Unterschied, ob sie 12 Stunden drinnen waren oder 12 Stunden und fünf Minuten, weil es das dann eine ganz andere Färbung ergeben hat.
EGC: Ach so, das wirkt sich auf die Färbung aus?
HB: Genau. Es war ziemlich anstrengend, das hinzubekommen. Die zugehörigen Arme wurden dann extrudiert: Ich habe von dem Armdurchmesser jeweils von meinen Eltern und von mir eine Extruderschablone aus Edelstahl gebaut, und dann wurde durch diese Form das heiße Material durchgeschossen. Am Schluss haben wir Arme und Hände miteinander verklebt und noch mal mit Talkum eingerieben. Das Ganze befindet sich auf einer Metallschiene und wird gehalten von Gummibändern, die auch aus dem Hause Läufer stammen.
EGC: Und für was werden diese Gummibänder für gewöhnlich benutzt?
HB: Die Gummibänder stammten aus der Produktion von diesen Haushalts-Ringgummis, und ich habe mir da, bevor die Ringgummis aus einem Schlauch geschnitten wurden, Gummirohlinge besorgt und aus diesen Bänder rausgeschnitten. Während ich an dieser Skulptur gearbeitet habe, habe ich immer die Arbeiter beobachtet, die diese ganz klassischen Läufer-Radiergummis produziert haben.
EGC: Diese Rot-Blauen?
HB: Diese Rot-Blauen, die wir alle kennen aus unserer Kindheit. Diese Radiergummis werden aus einem roten, einem blauen und aus einem weißen Teig, der den Kern bildet, gebacken. Gegenüber von meinem Arbeitsplatz in der Fabrik war dieser Ofen, an dem die Arbeiter immer wieder diese Teigplatten zusammengelegt haben. Sie haben die Platten unter Druck in den Ofen eingebracht und am Schluss kamen diese gestreiften Radiergummi-Platten raus. Zu der Zeit gab es so ein bisschen einen Streifen-Hype in der bildenden Kunst, und in meiner Galerie bei Bärbel Grässlin, gab es Leute wie Imi Knoebel, Günther Förg oder Meuser, die sich sehr ernsthaft mit dem Streifenbild beschäftigt haben. Ich habe mir da eigentlich einen Spaß erlaubt und habe dann diese Matten mitgenommen von den originalen Läuferradiergummis und habe sie dann auf Multiplex-Platten aufgezogen, an die Wand gehängt, und so eben ein Multiple hergestellt.
Das Interessante war, dass das erste Bild, das verkauft wurde, von Ika Huber, der Frau von Günther Förg, erworben wurde, und es gab dann, das hatte ich nicht erwartet, einen Riesen-Run auf diese Edition, weil es in irgendeiner Form bei den Leuten so eine Art Kindheits-Flashback gab. Dieses Rot und dieses Blau in Kombination mit dem sehr speziellen Geruch hat die Leute emotional stark angetriggert, so dass wir die Edition, das waren glaube ich 25 Bilder, innerhalb von ganz kurzer Zeit verkauft hatten. In der Folge habe ich noch mal eigene Kompositionen aus diesem Radiergummi-Teig in derselben Größe gemacht, die gingen dann als Unikate auf den Markt.
EGC: Kürzlich hat mich ein Berufskollege aus Hamburg angerufen, der Restaurator Thomas Hoppe, und hat mir ganz stolz erzählt, dass er ein unglaublich tolles Objekt gekauft hat in der Galerie Grässlin, und zwar ein Radiergummibild von Heiner Blum.
HB: Hm (schmunzelt)! Jetzt vor kurzem erst gekauft?
EGC: Ja, wohl dieses Jahr.
HB: Okay! – Was man vielleicht wissen muss als Restaurator, ist, dass der Radiergummi per se kein Material ist, das wirklich Jahrhunderte überdauern wird. Ich habe das gesehen bei Läufer, die über die Jahre immer wieder aus verschiedenen Chargen Radiergummis rausgenommen haben, um sie dann auf eine Muster-Platte zu kleben. Je älter die Radiergummis werden, je spröder werden sie, und auch die Farben bleichen etwas aus.
EGC: Fängt auch an bröselig zu werden.
HB: Genau, und das kann man nicht wirklich verhindern, oder auch nicht sagen, wie sich das jetzt in ein-, zweihundert Jahren entwickeln wird, und da der Radiergummi natürlich ein Material ist, der sehr stark mit Vergänglichkeit zu tun hat, in dem Sinne, dass er dafür zuständig ist, etwas Anderes auszulöschen und seinen eigenen Körper gleichzeitig aufbraucht, muss der Besitzer einfach auch damit leben, dass die Lebenszeit des Objekts begrenzt ist.
EGC: Das ist ja ein sehr schönes Bild, dass der Radiergummi sich selbst auflöst.
HB: Ja (lacht)!
EGC: Dann kommen wir jetzt zu den Bibendum-Bildern.
HB: Das ist eine Bildserie, die im Grunde genommen auch was mit Gummi zu tun hat: Die Firma Michelin hat seit über hundert Jahren eine Werbefigur, die aus übereinander gestapelten Reifen besteht. Ich habe mir das komplette Material über diese Figur besorgt und habe auf der Basis von vorhandenen Michelin-Männchen Variationen gemacht, die die Michelin-Männchen in diverse existenzielle Situationen bringen. Ich habe das dann von Zeichnern umsetzen lassen. Diese Serie ist noch nicht abgeschlossen, es gibt immer noch die Idee und Skizzen, weitere Motive herzustellen. Es macht einfach zu viel Spaß, als dass ich das jetzt abschließen würde.
Die Bibendum-Bilder sind von der Technik her sehr speziell: Das sind Aluplatten mit einem Wabenkern, der ist ungefähr ein Zentimeter dick, sie haben eine weiße Grundierung, die ich belassen habe. Auf die weiße Grundierung wurde eine Computer-geschnittene Folie aufgebracht und das Männchen wurde mit der Spritzpistole mit einem schwarzen Primer, einem Metallkonservierungslack in mehreren Schichten lackiert. Das Ganze sieht sehr glatt und industriell aus.
EGC: Und dieses Aluminiummaterial nennt sich Alucore?
HB: Genau.
EGC: Ist auch sehr stabil?
HB: Sehr stabil. Ist ein ganz tolles Material. Sehr teuer auch.
EGC: Ich glaube, das wird auch sehr viel in der Flugzeugindustrie verwendet...
HB: Ja, genau. Nachdem ich gerade in den 80er Jahren so viele schlechte Erfahrungen mit verzogenen Bildern gemacht habe, habe ich dann, als ich mir das leisten konnte, versucht, möglichst stabile Materialien einzusetzen.
EGC: Man kann beobachten, dass großformatige Fotografien, die im Diasec-Verfahren gearbeitet und auf Alu-Dibond-Platten aufgezogen sind, sich verwerfen können.
HB: Ja.
EGC: Und da gibt es zum Teil ziemlich aufwändige, rückseitige Konstruktionen, die das auch letztlich nicht verhindern.
HB: Ah, da bin ich ja beruhigt! (lacht). Ich habe immer gedacht, die Diasec-Fraktion ist auf der sicheren Seite.
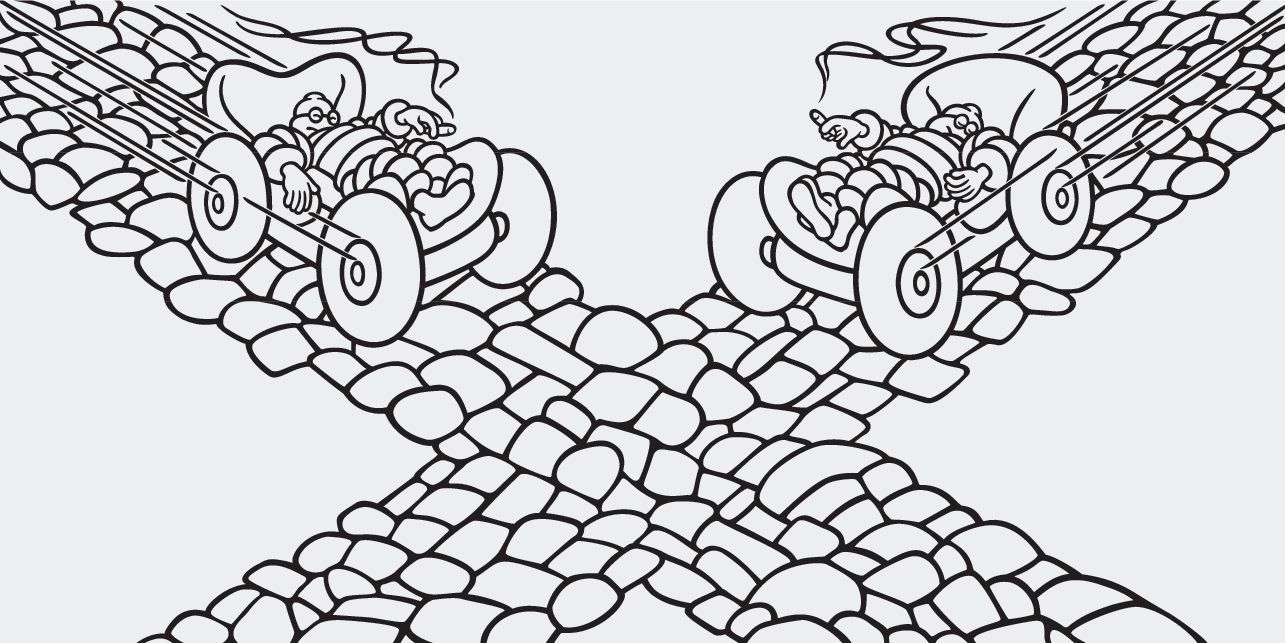
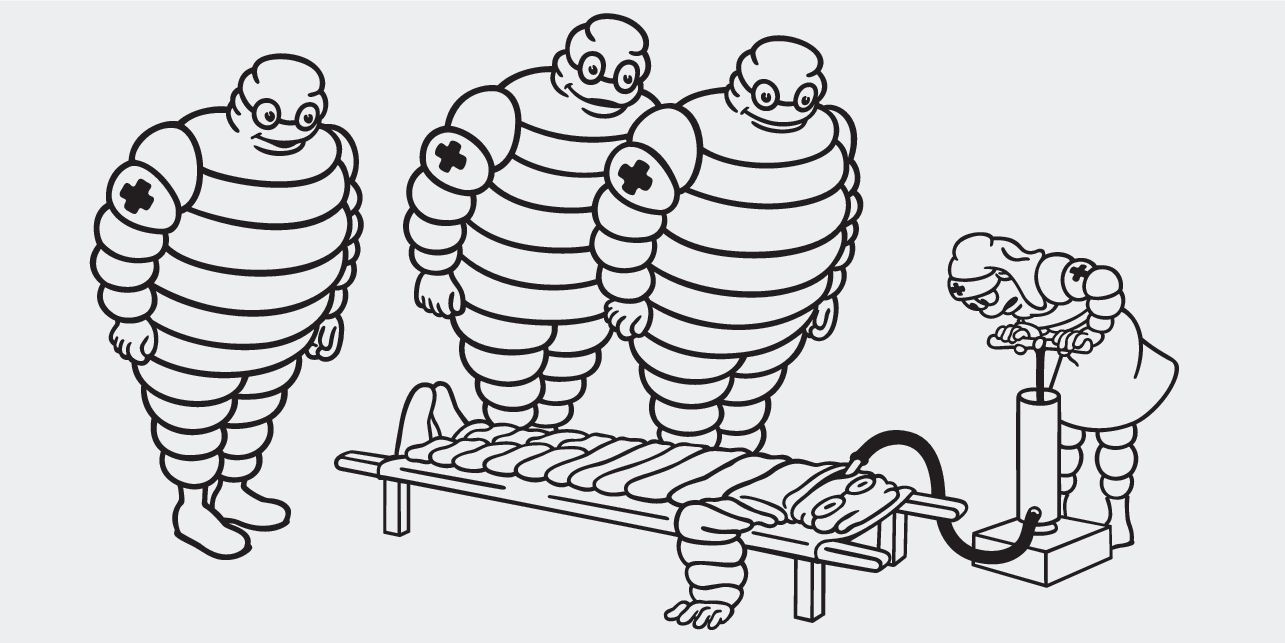

EGC: Jetzt kommen wir zu Skulpturen und Objekten. Da gibt es die schwarze Serie von 1986-1987, das sind 136 Objekte. Und das sind, glaube ich, alles Fundstücke.
HB: Genau.
EGC: Die Du ganz speziell behandelt hast. Kannst Du dazu etwas sagen?
HB: Diese Werkgruppe ist auch wieder im Rahmen der Reflexionen über Zeit und Vergänglichkeit entstanden. Ich hatte die Vorstellung, wie es wäre, wenn unsere Kultur irgendwann verschwunden wäre. Was würde man finden: Verkohlte Artefakte, auf Grund deren man Rückschlüsse ziehen könnte, auf unsere Kultur und Lebensweise. Das sind nicht wirklich Gegenstände, sondern so etwas wie abstrahierte Gegenstände. Ich habe für das Projekt relativ lange Zeit gesammelt und hatte dann eine gewisse Anzahl von Dingen, die natürlich alle sehr unterschiedlich waren. Ich wollte aber, dass alle einen einheitlichen Materialcharakter bekommen. Und dann bin ich auf einen Kautschuklack gestoßen, den man als Unterbodenschutz für Autos verwendet. Den habe ich in Frankfurt gegenüber vom MMK in Frankfurt gekauft.
EGC: Da ist so ein Autobedarfsladen.
HB: Nachdem ich die Gegenstände in verschiedenster Art und Weise vorbereitet und grundiert habe, wurden alle mit diesem Kautschuklack besprüht. Hinterher wurden die Gegenstände noch mal mit Talkum eingerieben, auch um so eine gewisse Glätte wegzunehmen. Interessant war, dass das Lösemittellack war, der sich nicht mit allen darunterliegenden Materialien vertragen hat. Ich hatte Probleme mit bestimmten Kunststoffen und Gummi.
EGC: Die darauf reagiert haben?
HB: Das Gummi hat manchmal angefangen zu schwitzen, ein paar Kunststoffe haben sich teilweise angelöst, und so habe ich eine ganze Reihe von Sachen, die ich eigentlich ganz gut fand, in die Tonne getreten.
EGC: Du hast es also nicht als ein Phänomen mit einbezogen?
HB: Nein, das hat mir nicht gefallen. – Für die meisten Objekte konnte ich aber relativ schnell Strategien entwickeln, das Anlösen zu vermeiden, das heißt, ich habe mit bestimmt vier, fünf unterschiedlichen Grundierungen gearbeitet, die dann das Material so abgesperrt haben, dass es eben nicht mehr mit diesem Lack reagieren konnte. Ich habe verschiedene Metallgrundierungen, Universalgrundierungen und Spezialgrundierungen für Kunststoff oder Gummi verwendet und die Sachen halten sich bis heute eigentlich auch ganz gut.
EGC: Die Objekte, die haben auf mich eine ganz besondere Wirkung, eine besondere Ausstrahlung. Das ist schwierig zu umschreiben.
HB: Viele von diesen Objekten sind auf der Basis von Verpackungen entstanden. Unsere Konsumgesellschaft leistet sich ja zum Beispiel den Luxus diese Blisterverpackungen um Produkte herum herzustellen. Und die sind nicht einfach nur irgendwie viereckig, sondern deuten oft die Form des Objektes an, das sie enthalten. Das Objekt selber hat mich oft weniger interessiert, vielmehr die angedeutete Form der Hülle, und deswegen gibt es das Phänomen, das einem diese Dinge in irgendeiner Form vertraut sind: Man hat das Gefühl, man kennt es irgendwie, was sich dahinter wirklich verbirgt, bleibt dann oft verborgen.
EGC: Ab 1995 entstanden über 20 geblasene Glasobjekte, die Du Gebläse nennst, und auch da würde es mich interessieren, wie die entstanden sind.
HB: Die entstanden erstmal auf der Basis von Handzeichnungen, die ich über längere Zeit gemacht habe. Diese Handzeichnungen bezogen sich auf archaische Kopfdarstellungen, auf so etwas wie Ritterhelme oder Kopfreliquiare. Dazu hatte ich in der Vorbereitung relativ viel Bildmaterial gesammelt.
Ich glaube, das Glas hat mich interessiert, weil eine Hauptquelle für die Formen diese Ritterhelme waren, die natürlich dazu dienen, den Kopf vor Verletzungen zu schützen. Im Gegensatz dazu hat es mich interessiert, ein ganz zerbrechliches Material zu wählen. Es war dieselbe Zeit, in der ich mich mit den Radiergummis beschäftigt habe, bei denen es ja eben auch darum ging, damit zu spielen, dass ein Kunstwerk ja immer einen Ewigkeitscharakter haben soll, und auf der anderen Seite dann auch mal zu probieren, wie fragil kann man überhaupt etwas machen und den Leuten, die das dann besitzen, ebenso eine gewisse Verantwortung aufzubürden, so dass sie quasi wie für ein Kind eine Zuständigkeit erhalten, sich drum zu kümmern, dass das Werk nicht kaputt geht. Mit den Zeichnungen bin ich dann zu einem Glasbläser gegangen, ich habe einen ganz tollen Chemieglasbläser gefunden in Frankfurt, den Herr Kergl. Der bläst normalerweise Spezialglasgeräte für chemische Versuchsanordnungen. Herr Kergl ist ein Mensch mit einem sehr großen ästhetischen Verständnis und ihm hat es unheimlich viel Spaß gemacht, die vertracktesten Konstruktionen für mich in Glas umzusetzen. Von der Grundform her sind das alles Chemiebehälter, Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc., die wir dann über dem Feuer verändert haben.
EGC: Das ist eine sehr fragile Serie.
HB: Ja, da ist bei einer Ausstellung auch schon mal von einer Kindergruppe, die da zu wild unterwegs war, eine Arbeit zerstört worden, und die gibt’s halt auch jetzt nicht mehr.
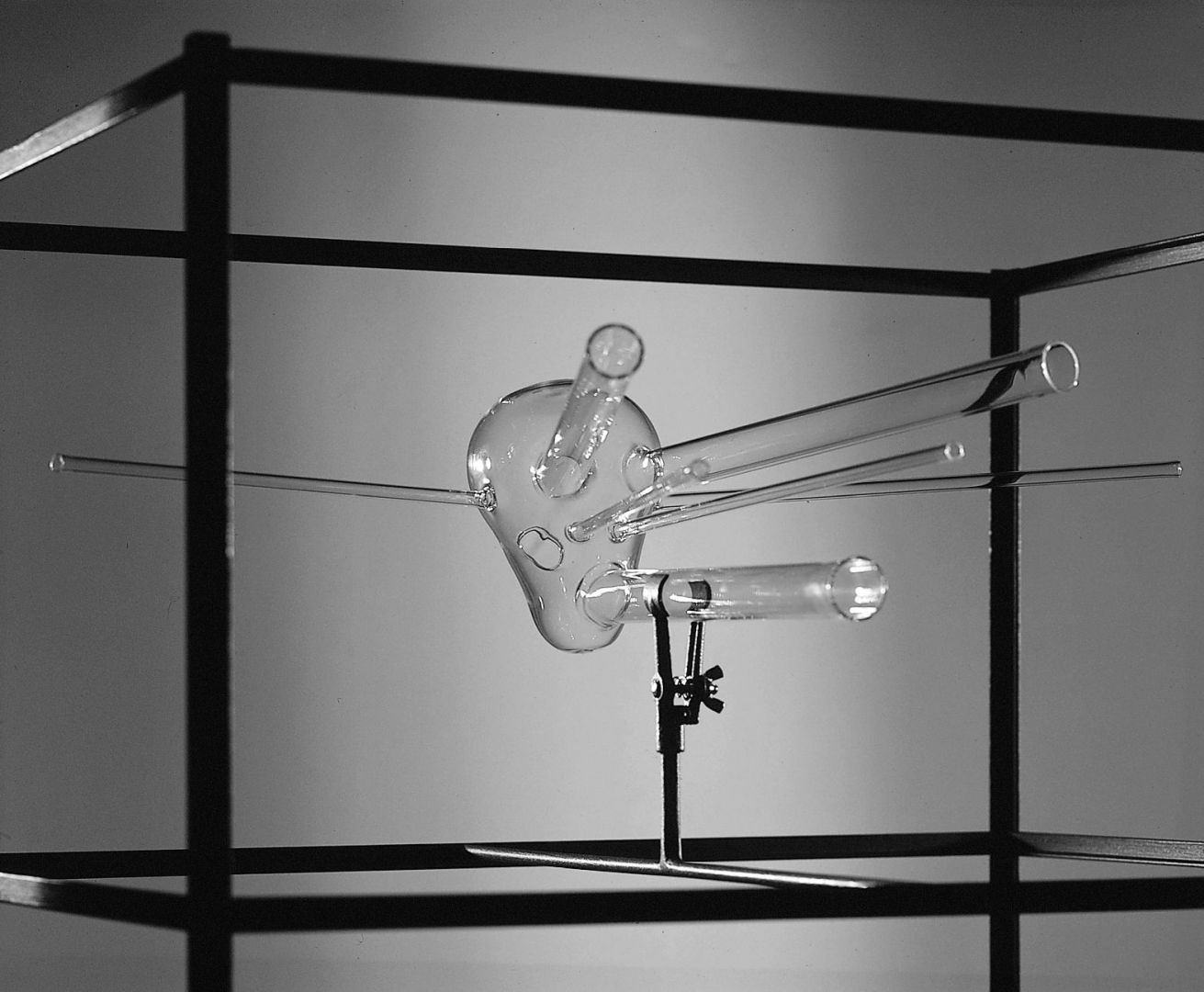

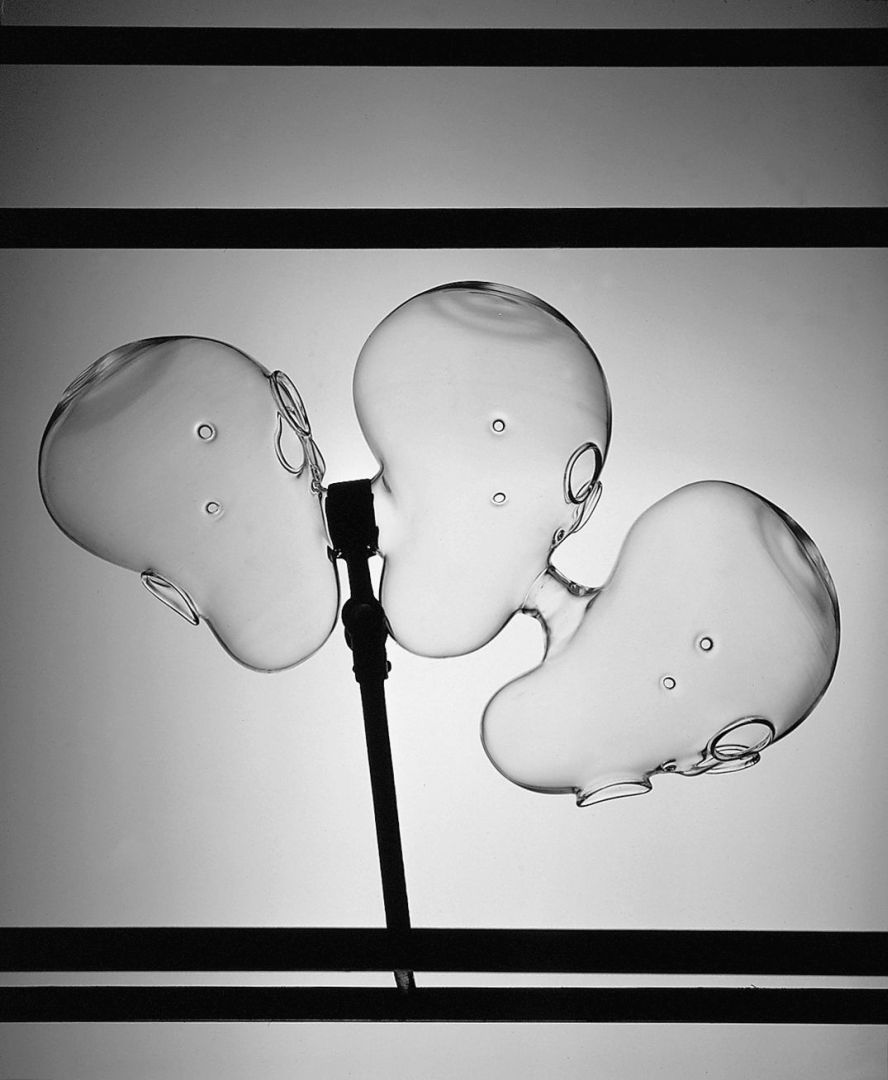

EGC: Jetzt kommen wir zu Kompositionen in Zeit und Raum.
HB: Das sind die Attrappen von Zeitzünderbomben. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Werkgruppe, die mir offensichtlich doch viel Spaß gemacht hat, sie ist bis heute noch nicht ganz abgeschlossen. Da gibt es, ich schätze, mindestens hundert Skulpturen.
Ich habe das Thema relativ genau recherchiert und durch einen Glücksfall habe ich auf dem Frankfurter Flohmarkt einen amerikanischen Soldaten getroffen, der, bevor er in die USA zurückging, Ausbildungsmaterial der amerikanischen Armee verkaufte. Da waren einige Bücher dabei mit Anleitungen zum Bombenbau. Ich habe weiterrecherchiert und habe einen paramilitärischen Versand in den USA gefunden, von dem ich mir auch noch Anleitungen für Sabotageaktionen habe schicken lassen. Das war relativ unkompliziert. Eine andere Quelle waren Filme, zum einen Spielfilme, zum anderen Zeichentrickfilme, in denen Zeitzünderbomben vorkamen. Im Grunde genommen habe ich Bilder von Zeitzünderbomben realisiert, denn eine richtige Zeitzünderbombe sieht doch eher aus wie ein Rucksack oder ein Koffer und nicht wie das, was ich da gebaut habe. Da gibt es die verschiedensten Varianten, zum Beispiel eine größere Gruppe auf der Basis von Papprohren, die ich mir habe wickeln lassen. Dann gibt es welche mit einer Art Kunststoffknete, und dann gibt es auch Objekte auf der Basis von Gegenständen wie Radios oder Fernsehern oder Puppen. Dann gibt es andere, die sehen harmlos aus wie eine Dose Ravioli oder ein Osterei, aber die ticken innen. Der Witz ist bei fast allen meinen Attrappen, dass die ganze Technik perfekt funktioniert, das heißt, im Grunde genommen müsste man nur eine scharfe Sprengladung darangeben, dann würden die Dinger auch funktionieren. Da hatte ich einen ganz großen Ehrgeiz zusammen mit meinem Assistenten Jörg Obenauer, die Sachen wirklich so zu bauen, dass sie auch hochgehen würden.
EGC: Ist ja interessant.
HB: Restauratorisch werden sich bei diesen Objekten im Lauf der Zeit ein paar Probleme ergeben. Da ich schon über zehn Jahre an den Bomben arbeite, deuten sich ein paar Schwierigkeiten an: Ich habe zum Beispiel diese Papprohre und andere Elemente mit Gewebeklebeband und anderen Tapes zusammengeklebt, teilweise sind die aber nicht von so einer guten Qualität. Sie fangen an, weich zu werden und schwimmen auf den Oberflächen. Das ist natürlich nicht so toll. Ich habe im Laufe des Prozesses Klebebänder ausgetauscht, aber die Probleme können natürlich wieder auftreten. Ein anderes Problem sind die Batterien: Ich hatte zuerst den Ehrgeiz, spezielle Batterien den Objekten zuzuordnen, da gab’s dann zum Beispiel eine Bombe, da waren zwei Batterien dabei mit einer kleinen Katze drauf, was ich vom Bild her ganz toll fand, aber wenn diese Batterien leer sind, dann bekommt man die nicht wieder, deswegen bin ich dann dazu übergegangen, Duracell Batterien zu nehmen, die einfach die langlebigsten sind und bei denen man davon ausgehen kann, dass es sie noch eine Zeit lang geben wird. Ich habe auch eine eigene Werkgruppe mit diesen Duracell-Häschen gemacht, die ja für zeitliche Ausdauer stehen und habe diese Hasen in Bomben umgebaut.
EGC: In dieser Serie der Zeitzünderbomben hast Du sehr viele Fundmaterialien verwendet?
HB: Ja. Das war aber auch, wie soll ich sagen, so ein Sport. Über zehn Jahre habe ich in Geschäften und Flohmärkten immer wieder potentielle Bestandteile geholt, in Elektroversandhäusern mir Sachen bestellt, ich habe exotische Kabel, Uhren und Tapes gesammelt und so weiter.
EGC: Die Serie, ist die jetzt für Dich abgeschlossen? Oder fasziniert das Dich nach wie vor noch?
HB: Es ist so, dass es praktisch noch eine ganze Reihe von Objekten gibt, die noch nicht ganz fertig sind. Oft ist es so, dass wir ein Objekt angefangen haben, aber dann fehlte noch die perfekte Uhr, oder es fehlte noch ein rotes Kabel, was dann nicht verfügbar war: Ich hatte nur ein grünes … Solche Details müssen jetzt noch erledigt werden, und dann ist die Werkgruppe abgeschlossen. Also, ich sammele da auch nichts mehr dafür. Teilweise sind auch die Beschriftungen noch nicht aufgebracht. Es befindet sich auf den Bomben in den meisten Fällen eine Schablonenbeschriftung, die dazu führt, dass das Ganze so einen militärischen Touch hat. Und diese Beschriftungen bestehen immer aus einer Buchstaben- und aus einer Zahlenkombination. Dieser Code weist auf eine Person hin, für jede Bombe gibt es einen Paten. Die Buchstaben sind die Anfangsbuchstaben von Vornamen und Namen und die Zahlenkombination das Geburtsdatum und die Uhrzeit, zu der die Person geboren wurde. Die Geburtszeit ist auch als Sprengzeit eingegeben auf der Uhr.
EGC: Rein fiktiv?
HB: Nein, nicht fiktiv! Die Leute gibt’s alle wirklich.
EGC: Die gibt’s wirklich?
HB: Ja.
EGC: Gibt es von mir auch eine?
HB: Habe ich von Dir die Daten? – Kann man noch machen!
EGC: Nein. Ist ja beruhigend (lacht).
HB: Zum Beispiel bei Thomas Grässlin in Sankt Georgen, im Eingangsbereich von seinem Haus, da steht die Martin-Kippenberger-Bombe (lacht). Die ist ja schon hochgegangen, im wahren Leben.




EGC: Zu Tische und Stühle, Deine Möbelserie.
HB: Tische und Stühle sind weitgehend zur selben Zeit entstanden wie die Zeitzünderbomben, mit einer Ausnahme: Während meines Fotografiestudiums hatten wir eine Aufgabe bekommen von unserem Professor, Gunther Rambow. Wir sollten uns ein Semester lang mit einem Stuhl beschäftigen. Er hat uns wöchentlich Aufgaben dazu gegeben. Die letzte Aufgabe war, dass wir den Stuhl in irgendeiner Form interessant vernichten sollten, und ich habe dann den Stuhl genommen, das war ein einfacher, weißer Küchenstuhl, habe vorne die Sitzfläche vom Rahmen gelöst, habe eine Feder eingebaut und habe unter der Sitzfläche eine Klingel angebracht. So, dass der Stuhl, solange man auf ihm sitzen wollte, unaufhörlich geklingelt hat, und sobald man runtergegangen ist, war er eben wieder ruhig.
EGC: Das ist doch ein Druckkontakt.
HB: Genau. Und, diesen Stuhl habe ich damals weggeschmissen, weil ich es nicht so ernst genommen habe. Später habe ich ihn noch mal reproduziert, und es ist dann eine ganze Reihe von Tisch- und Stuhlskulpturen entstanden in den 90er Jahren, die so ein bisschen mit diesem Bild spielen, das man vor sich hat, wenn man abends zu lang in der Kneipe sitzt: Dann kommt irgendwann der Wirt und stellt die Stühle auf den Tisch, und man weiß, man muss gehen. Und damit spielen diese Arbeiten. Das sind aber keine Kneipenmöbel, sie haben eher eine Küchentischästhetik, so aus den 50er, 60er Jahren.
EGC: Sind die speziell angefertigt?
HB: Nein. Ich habe relativ intensiv Stühle und Tische gesucht, richtige Tische und Stühle, die schon ein Leben gehabt haben. Sie wurden teilweise umgeändert und schreinertechnisch weiterverarbeitet. Ich habe sie schließlich mit Kunstharzlack gestrichen, ganz klassisch wie man Möbel streicht, das heißt, es gab eine Grundierung und dann habe ich einen Seidenmattlack verwendet. In der Regel einen weißen Lack, dem ich immer eine leichte Tönung gegeben habe. Manchmal einen Chamois-Stich, manchmal einen Graustich, manchmal so ein leichten Grünstich. Immer so ein bisschen anders, das war mir sehr wichtig. Die Farbschichten wurden alle mit einem Ringpinsel aufgetragen; der Farbauftrag war für mich sehr wichtig, das kann man nicht einfach so überwalzen. Am Schluss, weil mir dieses Seidenmatt ein bisschen zu glänzend war, habe ich Scheuerpulver genommen und habe dann mit dem Scheuerpulver und einem feuchten Schwamm diese Tische und Stühle noch mal ein bisschen mattiert.
EGC: Also eine sehr delikate Oberfläche?
HB: Ja, ja. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht.
EGC: Jetzt kommen wir zu der Gruppe der Textilien. Da gibt es die Arbeiteranzüge, die T-Shirts, die Hoods und die Schals. – Fangen wir mit den Arbeitsanzügen an.
HB: Das ist eine relativ frühe Geschichte, bei der es darum ging, für den menschlichen Körper ein gestalterisches Äquivalent zu finden, und da bin ich auf diese blauen Arbeiteranzüge gekommen. Da gibt es einige, bei denen ich hinten drauf Symbole gedruckt habe und andere, auf denen man Begriffe lesen kann. Technisch habe ich eine aufbügelbare Folie verwendet, die ich in einem T-Shirt-Shop gekauft habe. Die Folien habe ich mit der Hand ausgeschnitten. Computerplotter gab es damals noch nicht.
Und dann die T-Shirts und Hoods, das ist eine Serie, an der ich persönlich sehr hänge. Sie ist aber noch nie in irgendeiner Ausstellung gezeigt worden. Viele Sachen, die ich mache, fallen einfach durchs White Cube-Raster: Keine Bilder, keine Skulpturen, und dann sieht es wieder so ein bisschen aus wie Mode, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Bei dieser Werkgruppe geht es darum: Zwei Kleidungsstücke, die ich selber zu der Zeit gern getragen habe, schwarze Kapuzenpullover und weiße T-Shirts, werden mit den gestalterischen Parametern, die im Kleidungsstück enthalten sind, modifiziert.
Im Grunde genommen sind das so Remixe aus diesen Kleidungsstücken. Die Kleidungsstücke kann man tragen, aber dann doch wieder nicht, weil sie irgendwo für den Träger oft ein bisschen peinlich wirken könnten. Die ganze Geschichte lässt sich über Fotos ganz gut kommunizieren, aber ich könnte mir auch eine Präsentation vorstellen lassen, bei der man die Kollektion auf einem Präsentationsgestänge zeigt.
EGC: Und gab es bisher immer nur ein Stück? Oder kann man sie schon von der Stange kaufen?
HB: Es gibt von den meisten nur ein Stück, und es gibt dann ein paar, die ich eher als tragbar einschätze, von denen ich mehrere produziert habe.
EGC: Und die Materialien sind die gleichen, wie von ihren Schwestern und Brüdern?
HB: Im Grunde genommen sind alle aus Hoods beziehungsweise T-Shirts gemacht.
EGC: Die Schals haben wir noch nicht besprochen.
HB: Ja, dann machen wir das jetzt! Da gibt’s eine Reihe von schalartigen Arbeiten. Die lehnen sich an die Ästhetik von Fußballschals an. Mich hat das immer sehr beeindruckt, dass Leute ihrer sportlichen Gesinnung in Form eines Schals eine sehr große Präsenz geben und sich damit sehr erkennbar machen für die Gleichgesinnten, aber auch für die Feinde. Diese Schals sind typografisch und grafisch sehr interessant, und ich habe in Bezug darauf eigene Schalmotive entwickelt, die aber eher von der Inhaltlichkeit eine existenzielle Grundlage haben. Sie beziehen sich eigentlich auf alles andere als Sport. Die Schals sind tragbar, wir haben sie dann auch relativ günstig gemacht, es gibt sie in einer zehner Auflage, aber die meisten Leute, die sie gekauft haben, die horten sie eher, als dass sie sie tragen.
EGC: Und wo wurden die hergestellt?
HB: Die wurden in Süddeutschland hergestellt, da gibt es einen Ort, in dem die meisten deutschen Fußballschals produziert werden. Ich habe da mit verschiedenen Produzenten Tests gemacht. Die meisten Muster, die ich bekommen habe, waren so, wie die Schals, die man von der Bundesliga kennt: relativ grob. Dann bin ich auf einen Musterhersteller getroffen, der mehrere Silicon-Graphics-Computer an eine Strickmaschine angeschlossen hatte. Das war ein sehr feinsinniger Mensch, der sich darauf eingelassen hat, die Schals in der Qualität zu produzieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war aber schon ein langer Weg. Das sieht jetzt am Schluss so einfach aus, also, überhaupt diese Person zu finden und praktisch diesen ganzen Herstellungsprozess so zu manipulieren, dass am Schluss dann auch so ein High-End-Ergebnis herauskommt.
EGC: Darf ich fragen, was so ein Schal kostet?
HB: Den haben wir, glaub ich, damals für 750 Mark verkauft.
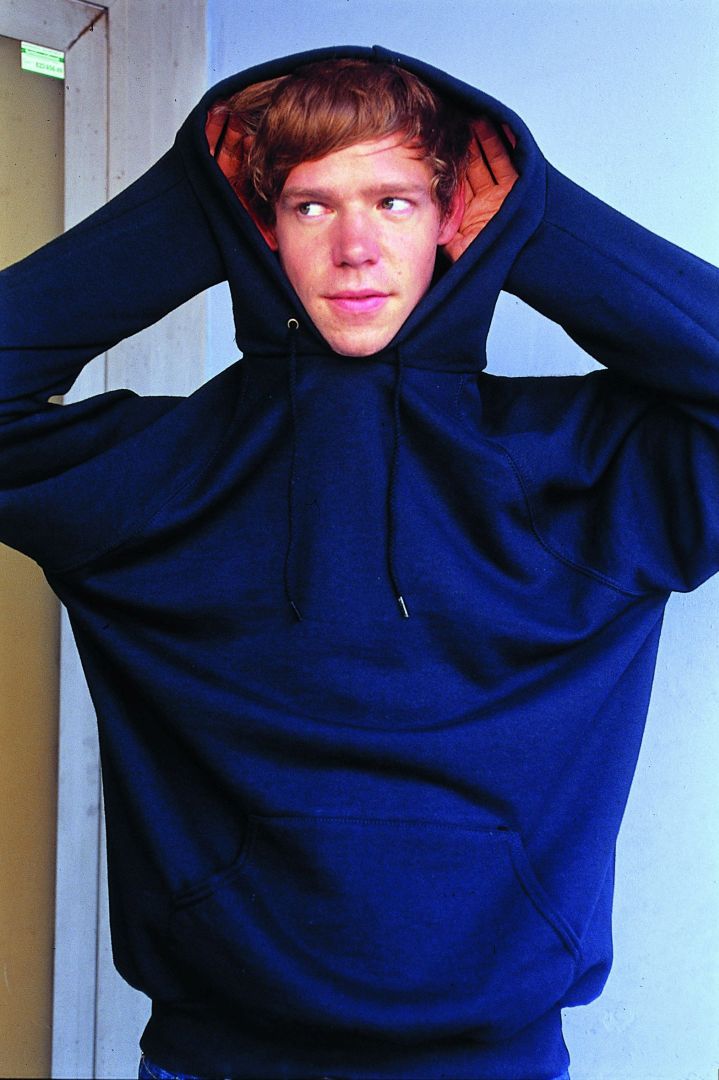


EGC: Jetzt zu den Fenstern, den temporären Fenstern.
HB: Als wir vorhin über diese schwarz-weißen Shaped Canvas-Bilder gesprochen haben, hatte ich erzählt, dass ich schon zu der Zeit der Herstellung nicht so ganz glücklich war mit der technischen Qualität. Und in Kassel, wo ich damals gewohnt habe, kam es im Kunstverein zu einer ersten Ausstellung in den achtziger Jahren, 1985, da habe ich die zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Bis zu dem Zeitpunkt war ich für die meisten Leute Fotograf, und das hat sich damit geändert. Das Interessante war, dass ich so ein bisschen schüchtern war, mit etwas Neuem an die Öffentlichkeit zu gehen und, wie gesagt, die technische Qualität fand ich nicht so top. Im Nachhinein waren die total in Ordnung, die Bilder. Ich habe die Fenster im Ausstellungsraum von außen schwarz lackiert, so dass sich eine Art schwarze Spiegel ergeben hat, und zudem habe ich noch, das habe ich in der Folge öfter gemacht, die Leuchtstoffröhren in diesem Raum mit Architektenentwurfsfolie umwickelt, damit es noch ein bisschen dunkler war. Und eigentlich alles aus dem Grund, weil ich einfach scheu war und mich nicht richtig getraut habe, die Sachen zu zeigen. Aus diesen lackierten Fenstern ist dann eine eigene Werkgruppe entstanden. Ich habe bei der nächsten Ausstellung, ich glaube, das war bei der Galerie Nächst St. Stephan in Wien, die Fenster vor dem Lackieren von außen schabloniert, so dass drei durchsichtige Punkte auf jedem Fenster blieben, in Form von einem Blindenzeichen. Durch dieses Blindenzeichen konnte man nach draußen gucken.
Es war später eine Ausstellung bei Bärbel Grässlin, bei der habe ich Ziffernblätter auf die Fenster gemacht, durch die man raus- und reingucken konnte. Noch später gab es ein paar Varianten von Fenstern. Ich mochte die eigentlich immer ganz gerne, aber ein Problem war natürlich, dass diese Fenster dann nach der Ausstellung wieder abgekratzt wurden und als Arbeit dann verloren gingen.
Zu der Zeit hatte mich das Sammlerehepaar Feldmann aus Frankfurt angesprochen, die wollten für ihr Treppenhaus ein Fenster haben, und dann habe ich eben ein Motiv gemacht mit Bleiglas, das fand ich sehr faszinierend, weil ich sehr interessiert war an alter Kunst.
Ich habe das ja vorhin bei den Glasskulpturen bereits beschrieben, dass sich die auch auf Ritterrüstungen und alte religiöse Kunst bezogen haben. Und so ein Bleiglasfenster zu machen, war ein Traum für mich. Ich habe da ein sehr einfaches typografisches Motiv mit rotem und transparentem Glas umsetzen lassen. Das ist auch bisher das einzige Bleiglasfenster, das es von mir gibt. Leider!
In der Folge gab es weitere Glasarbeiten, die aber eben nicht durchsichtig waren, sondern bei denen praktisch an Stelle des durchsichtigen Glases eine Spiegelfläche aufgebracht wurde. So entstand aus einer Arbeit, die ich an Fenstern in Rotterdam gemacht habe, die erste Spiegelarbeit.
Das waren so ganz reduzierte Figuren. Ich habe diese Figuren noch mal auf Glasscheiben lackiert und habe die dann von einer Firma in Dortmund von hinten verspiegeln lassen. Das Besondere diese Spiegel ist, dass sie von Wandhalterungen aus Vierkantrohr so ungefähr 15 cm vor der Wand gehalten werden, so dass eine Tiefe entsteht und das Ganze einen plastischen Charakter bekommt. Aus der Zeit gibt es eine ganze Reihe von diesen Spiegelarbeiten, die immer in derselben Technik entstanden: Die Glasscheiben wurden von hinten, meistens mit einer Glas-Siebdruckfarbe von Marabu mit der Walze lackiert, vorher schabloniert, und wurden dann verspiegelt. Bei dem Verspiegeln habe ich meistens mit der Firma Wertz in Dortmund zusammengearbeitet. Das waren zwei Jungs, die das von ihrem Vater gelernt hatten. Die haben am Anfang noch mit einem so genannten Schwenktisch gearbeitet: Da wird die Glasplatte draufgelegt, gereinigt und dann wird darüber eine Kanne mit zwei Kammern, in der sich zwei verschiedene Flüssigkeiten befinden, ausgegossen. Im Moment des Ausgießens verbindet sich das. Der Schwenktisch ist dabei die ganze Zeit in Bewegung. So fällt auf dem Glas reines Silber aus und wenn dieser Vorgang beendet ist, wird es getrocknet und dann noch mal mit einer grauen Schicht versiegelt und gegen Oxidation geschützt.
In der Technik habe ich auch noch mal in Barcelona mit Spiegelmachern eine ganze Serie produziert. Später sind die Wertz-Leute zu einer neuen Technik übergegangen, sie haben dasselbe Verfahren mit einer Spritzpistole gemacht, das heißt, man hat da eine Spritzpistole mit zwei Zuleitungen und in dem Moment, in dem der Nebel ausgetreten ist, ist das Silber ausgefällt und hat sich auf das Glas niedergelassen. Da konnte man auch größere Flächen realisieren.
EGC: Ohne dass auf den Bildern Orangenhaut entstanden ist?
HB: Ja, das ist von vorne ganz glatt, es wurde immer von hinten verspiegelt. Davon gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten. Wenn man das restauratorisch über längere Zeit beobachtet, könnte es sein, wie bei normalen Spiegeln, dass so ein Stück Spiegel vielleicht mal blind wird, wenn das nicht richtig entfettet wurde oder bei einem mechanischen Schaden. Das finde ich bis zu einem gewissen Grad akzeptabel, man könnte im Grunde genommen auch die ganze Silberschicht runterholen, die Farbschicht lassen und dann neu verspiegeln. Das wäre durchaus eine Variante, die in Ordnung wäre.
EGC: Machen wir weiter mit den Spiegeln. Da gibt es diese Arbeit Werte von 1995, ein Spiegelkorridor im Eingangsbereich von »Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co« in München in der Maximilianstraße.
HB: Ich habe bisher über Spiegel gesprochen, bei denen ich nur mit Schwarz und Silber gearbeitet habe. Und dann gab es eine Anfrage für einen Eingangsbereich von einer Privatbank in München, und da habe ich mich entschieden, auf beiden Seiten Spiegel aufzuhängen, die die ganze Wand bedecken. Für einen kleinen Teil habe ich auch mit farbigen Lacken gearbeitet. Vom Thema her geht es hier um Werte unserer Zivilisation.
EGC: Was für Lacke hast Du dafür verwendet?
HB: Das ist ein Lack, mit dem ich sehr zufrieden bin, von der Firma Marabu, der extra gefertigt wird, um auf Glas zu drucken, damit habe ich nie ein Problem gehabt.
EGC: Und wie hast Du das verarbeitet? Mit dem Pinsel oder mit der Spritzpistole?
HB: Gewalzt. Mit einer Velourwalze.
EGC: Mit einer Velourwalze.
HB: Das mache ich im Liegen und die Lackschicht zieht sich zu einer ganz homogenen Fläche zusammen. Es ist also kein großes Problem, das sauber hinzukriegen.
EGC: Ferner gibt’s auch noch diese Komposition in Silber und Schwarz, eine Installation im Frankfurter Kaufhof.
HB: Das Ganze ist eine Edition, die haben wir einmal im Frankfurter Kaufhof gezeigt.
EGC: Das ist keine Dauerinstallation?
HB: Nein, das war nicht speziell dafür gedacht. Das lag daran, dass in Frankfurt der Kunstverein mal abgebrannt war … Und Peter Weiermeier wollte trotzdem weiter Ausstellungen machen, bis der Schaden behoben war.
EGC: Dann war es eine Off-Site-Situation.
HB: Und dann hatte er sich überlegt, wie man in der Stadt Kunst zeigen könnte. Er hat verschiedene Künstler angesprochen, und ich hatte zu der Zeit das Projekt Komposition in Silber und Schwarz mit der Edition Artelier in Graz produziert. Das waren Spiegel, wie man sie als Überwachungsspiegel kennt, also diese gebogenen Spiegel, und der Kaufhof war inzwischen dazu übergegangen, diese Spiegel alle abzubauen und eben zu anderen Überwachungstechniken überzugehen, zu diesen Pfosten, die man links und rechts von den Eingangstüren sieht und die dann ein Signal melden.
EGC: Diese elektronischen Melder?
HB: Ja, genau. Und ich habe im Kaufhof diese Spiegel wieder reingehängt. Wir hatten das damals in Graz produziert, das war eine ziemlich aufwändige Geschichte. Diese Gläser haben wir uns von einer Firma aus Deutschland nach Österreich schicken lassen und die Grazer haben dann einen speziellen Rakel gebaut, der in diesen Hohlraum, in diese Vertiefung reingepasst hat. Und wir haben diese ganzen Motive mit Sieben da rein gerakelt, was echt ein ganz schöner Stress war. Dann wurden die wiederum in Dortmund versilbert und Artelier hat dann noch Halterungen dazu gebaut: Also, da habe ich bis heute Respekt, dass die so ein aufwändiges Projekt durchgezogen haben, aber das ist auch so ein bisschen die Spezialität von denen.
EGC: Die haben sehr gute Arbeit geleistet.
HB: Artelier gibt’s heute noch!


EGC: Artelier hat für Martin Kippenberger auch sehr viel gearbeitet.
HB: Genau. Ja, ja, das lief damals auch über eine Empfehlung von Martin Kippenberger, der mir in dieser Zeit sehr geholfen hat. Er hat der Arbeiten von mir gekauft und mich weiter empfohlen. So bin ich damals zu Artelier gekommen. Das war toll. Aus dieser ganzen Beschäftigung mit Glas hat sich dann noch eine andere Technik entwickelt, die ich jetzt öfter schon in Kunst-am-Bau-Zusammenhängen verwendet habe, nämlich das Sandstrahlverfahren. Das habe ich das erste Mal bei einer riesigen Arbeit verwandt, die es in München gibt. Die Arbeit heißt Lexikon und ist bei einem städtischen Gebäude eine Fläche, ich glaube von 150 m Länge, die aus, jetzt müsste man mal nachzählen, fast 100 Glasscheiben besteht, die insgesamt so was wie ein Lexikon unserer Zivilisation bilden.
Das sind figurative, abstrakte, typografische Motive, die eben zu einer großen Arbeit zusammengefügt sind. Die ganze Arbeit ist auf der Basis von Recherchen am Computer gezeichnet worden und wurde dann Motiv für Motiv auf Folie ausgeplottet. Diese Folien wurden aufs Glas aufgetragen, und da wo keine Folie war, wurde dann eben mit einer Sandstrahlmaschine mattiert.
EGC: Das heißt, das Motiv ist transluzid, also durchscheinend?
HB: Genau. Beim Sandstrahlen entsteht eine weißliche Mattierung auf dem Glas. Mit gefällt die Technik sehr gut, weil sie sehr diskret ist, und man als jemand, der in Räumen mit diesen Scheiben zu tun hat, sich immer aussuchen kann, ob man die Arbeit wahrnehmen will oder nicht.
Die Technik habe ich noch mal verwendet in der hessischen Staatskanzlei, für die ich ein Projekt mit dem Titel Hotel Rose realisiert habe. An 45 Fenstern habe ich Texte von hessischen Autoren anbringen lassen.
Die funktionieren wie Untertitel zu einem Film, das heißt so ein Text ist praktisch immer ein Kommentar zu dem, was sich außen abspielt. Ich habe vorher die Texte am Computer in der Garamond gesetzt, der Hausschrift des Suhrkamp-Verlags. Dann wurden Schrift-Schablonen auf die Fenster aufgebracht und an den entsprechenden Stellen mattiert. Das ist ziemlich unkompliziert. Normalerweise kann man das am Besten in einer Sandstrahlanlage machen, bei der eine Sandstrahldüse in einem ganz regelmäßigen Duktus über Kreuz über eine Scheibe geführt wird. Diese ambulante Geschichte, wie bei Hotel Rose, das muss man schon können.
Bei Hotel Rose war es so, dass die Flächen relativ klein waren, aber ich habe dann in der Folge Motive verwirklicht in der Uniklinik in Frankfurt, wo wir große Figuren auf Fenster aufgebracht haben. Und da hat sich rausgestellt, dass die Firma, die das realisiert hat, sich ein paar sehr gravierende Aussetzer geleistet hat, so dass die Motive zum Teil jetzt in meinen Augen ein bisschen verdorben sind. Ich habe in der Folge mit der Firma auch nicht mehr weitergearbeitet.


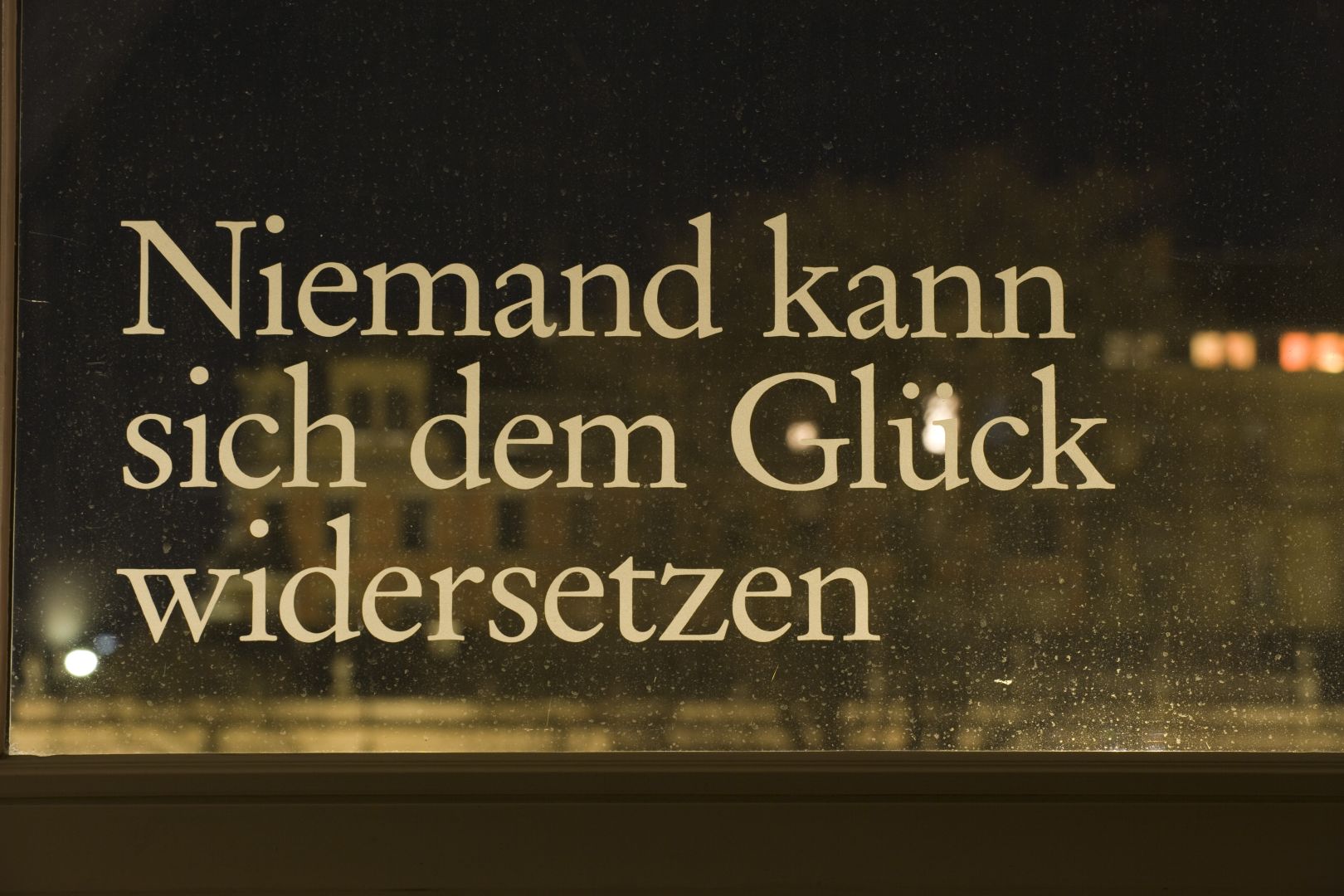
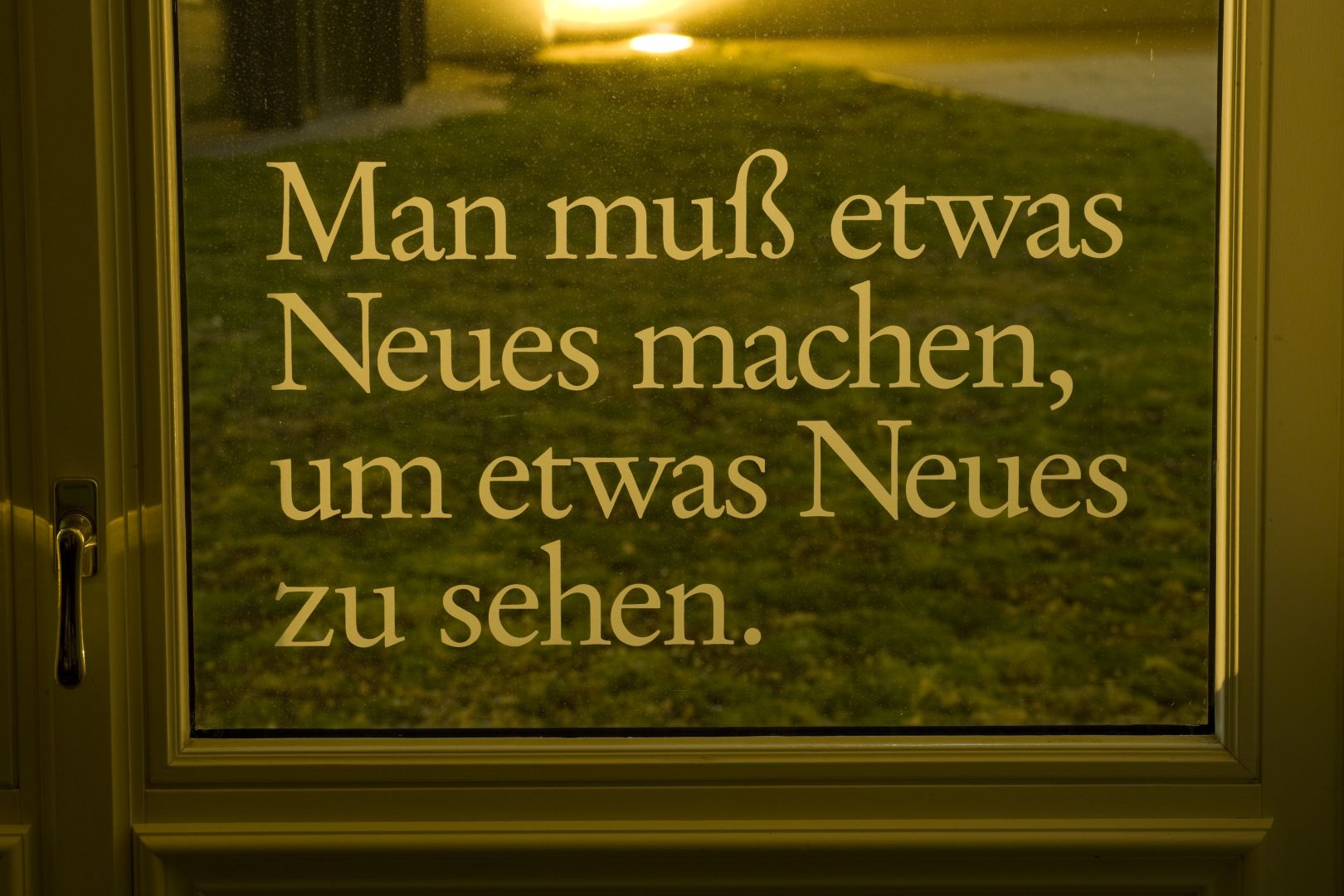

EGC: Wie hieß die Arbeit, Glücksmomente?
HB: Genau. Bei dieser Arbeit war es so, dass ich ähnlich wie bei Hotel Rose auf das vorhandene, schon eingebaute Glas draufgegangen bin. Glücksmomente ist Kompendium von Motiven, wie man sie zum Bespiel aus dem eigenen Familienalbum kennt, wenn man versucht, einen glücklichen Moment festzuhalten. Die Bilder sind fast alle von mir selbst fotografiert, oder es sind Samples, die ich mit eigens dafür fotografierten Gesichtern oder Händen ergänzt habe. Nach dem Fotografieren werden die Motive komplett nachgezeichnet. Ein Zeichner braucht ungefähr eine Woche für ein Bild, allein für die Haare zwei Tage, und am Schluss entstehen dann Zeichenwegdateien, die als Folie ausgegeben werden. Die Folien werden vor Ort aufgeklebt und dann eine Kabine wird drum rum gebaut, dann wird das vor Ort mattiert und am Schluss noch mal mit einem Griffschutz versiegelt. Die Sandstrahlflächen sind, wenn man sie nicht versiegelt, relativ empfindlich gegen Fett, aber es gibt da eine Flüssigkeit ClearShield, die ziemlich unkompliziert aufzubringen ist, so dass man dieses Problem nicht hat. Die Motive wirken auch durch die Flüssigkeit noch ein bisschen homogener und brillanter.
EGC: Jetzt habe ich noch eine Frage zu Lexikon. Sind die Glasscheiben dort spezielle?
HB: Nein, das ist ganz normales Floatglas.
EGC: Weißes oder Grünes?
HB: Grünliches, durchsichtiges Floatglas, also jetzt nichts Teures, und das ist für die Bauherren immer interessant, so dass eine Arbeit nicht so viel kostet, wie mit Bleiglastechnik. Die bereits eingebauten Scheiben können verwendet werden, so dass im Grunde genommen nur die Kosten für das Sandstrahlen entstehen. Es gibt da aber immer wieder Probleme mit der Gewährleistung, und das wird je nach Bauleitung immer anders gelöst: Also in München zum Beispiel gab es keine Schwierigkeiten, aber in Frankfurt an der Uniklinik hat der Glasbauer gesagt, wenn wir auf seine Scheiben mit der Sandstrahltechnik draufgehen, erlischt seine Gewährleistung. Das Problem ist, dass eigentlich das Sandstrahlen mit den Gläsern nichts anstellt, was die Gläser dazu bringen würde, in irgendeiner Form sich negativ zu verhalten. Es ist einfach eine prinzipielle Geschichte, dass die Glasbauer sagen: Okay, wenn jemand da mit unseren Gläsern rummacht, sind wir nicht dafür zuständig, wir haben die Gläser durchsichtig eingebaut und alles andere ist dann nicht unser Problem. Und da ist in Frankfurt das Problem entstanden, dass die Bauleitung darauf kam, mir eine irrsinnig teure Glasversicherung aufzubrummen, die ich von meinem Künstlerhonorar bezahlen musste, obwohl sie vollkommen sinnlos war.
EGC: Und die Sache ist gut ausgegangen?
HB: Ja, pfffff! Also der Einzige, der der am Schluss glücklich war, war die Versicherung. Durch das Sandstrahlen passiert nichts Schlimmes, das ist vollkommen ungefährlich. Ich habe eine weitere Arbeit in der Technik in der Kinderklinik Heidelberg gemacht, da habe ich mit krebskranken Kindern verschiedene Motive erarbeitet, die wir dann auch mit Schablonentechnik aufs Glas aufgebracht haben. Und da haben die Bauleute von mir verlangt, dass ich über den Betrag, den es kosten würde, auf eine neu einzubauende Glasscheibe das Motiv wieder aufzutragen, eine Versicherung abschließe. Es werden Bau-Sitzungen einberufen, die dauern oft über zwei, drei Stunden, und dann wird einem so eine Geschichte aufgebrummt. Was im Grunde genommen vollkommener Quatsch ist! Der Witz an der ganzen Technik ist natürlich der, dass man tatsächlich so eine Scheibe wieder ganz leicht herstellen kann. Die Dateien, die Zeichenwegdateien sind eins zu eins angelegt, und es ist kein Thema, so eine Schablone wiederherzustellen und ein Motiv erneut sandzustrahlen. Es sieht dann genauso aus, und es ist für mich dann auch dieselbe Arbeit.
EGC: Heiner, kannst Du noch was zu dem Projekt Kinderspiele in Heidelberg sagen? Um welche Art von Klinik hat es sich da gehandelt?
HB: Ich habe generell den Anspruch, wenn ich in architektonischen Zusammenhängen arbeite, Werke anzubieten, die belebt sind, und nicht nur für die Kunstgeschichte zu arbeiten. Ich möchte immer, dass es da eine Identifikation gibt von den Leuten, die das Gebäude bewohnen oder nutzen, und im Fall von diesen Klinikbildern ist mir natürlich auch wichtig, dass die Stimmung der Leute, die sich in der Klinik aufhalten, in irgendeiner Form aufgehellt wird. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Arbeiten von mir im White Cube-Kontext, die relativ düster sind. In den Krankenhäusern, in denen, sagen wir mal, doch sehr düstere Lebensmomente aufkeimen, ist es das Gegenteil: Da versuche ich Bilder zu finden, die dunkle Gedanken durch helle Gedanken ersetzen können und den Leuten so eine Möglichkeit geben, sich aus so einer auch schlimmen Situation so ein bisschen raus zu ziehen. Diese Kinderspiele in Heidelberg basieren auf einer Reihe von Fotos, die ich mit krebskranken Kindern in einem Camp bei Heidelberg erarbeitet habe. Sie kommen sehr lebensfroh rüber, aber auf der anderen Seite gibt es da Codes, die darauf hinweisen, dass es sich um sehr, sehr zerbrechliche Situationen handelt. Das ist eine Ebene, die da durchaus mitschwingt. Im Fall der Uniklinik Frankfurt ging es um Glücksmomente, wobei ich festgestellt habe, dass diese glücklichen Motive eigentlich immer in Kontrast zu gewissen melancholischen Momenten besonders stark rüberkommen.
EGC: Ist die Arbeit Glücksmomente in der Uniklinik in Frankfurt in einem Kinderbereich?
HB: Nein, die ist in verschiedenen Bereichen der Klinik.
EGC: Und in Heidelberg?
HB: In Heidelberg ist es eine reine Kinderklinik. Da ist so eine Art Durchgang, der direkt nach dem Eingangsbereich kommt, durch den fast alle Patienten durchmüssen. In Frankfurt ist es über die ganze Klinik verteilt, an den verschiedensten Stellen.
EGC: Das heißt, Arbeiten in solch einem sozialen Kontext interessieren Dich sehr stark?
HB: Ja, das ist etwas, was ich sehr interessant finde, da die Arbeiten letztendlich an diesem Ort auch bleiben. Und das ist ja durchaus etwas, was lange Zeit in der Kunst selbstverständlich war. Wenn man an die ganze Kirchenkunst oder die höfische Kunst denkt, so haben hier die Künstler oft für einen bestimmten Ort eine Arbeit gemacht und wussten, das Werk befindet sich dann einfach für die nächsten zighundert Jahre an dieser Stelle, das ist etwas, das mich sehr interessiert. Diese White Cube-Idee, bei der man für vier Wochen einen weißen Raum bestückt, finde ich doch sehr speziell. Ich finde das auf der einen Seite interessant, auf der anderen Seite reizt es mich doch sehr, auch in permanenten Situationen ausgestellt zu sein.
EGC: Dadurch entsteht eben auch so eine ganz andere Form von Kommunikation für den Betrachter. Es ist eine breitere Masse, die angesprochen wird.
HB: In dem Fall ist es mir wichtig, dass, bevor die Leute merken, dass es ein Kunstwerk ist, eine direkte Wirkung eintrifft, die funktioniert.
EGC: Ja.
HB: Und erst in zweiter Instanz überlegt sich der Betrachter: Ja, ach so, das hat da wahrscheinlich ein Künstler gemacht.
EGC: Nun wären wir jetzt bei den Leuchtkästen angekommen. Zunächst zu den Lichtmühlen.
HB: Die Lichtmühlen, das sind Objekte auf der Basis von einer Art Lampe, die man handelsüblich erwerben kann. Das ist so ein Draht-Metall-Gestell mit einer Glühbirne darin. Außen herum ist so ein weißer Schirm und innen bewegt sich durch die Hitze des Lichts eine Walze mit dem Projektionsmotiv. Normalerweise ist auf dieser Walze ein buntes, kinderartiges Motiv. Ich habe mir diese Lampen besorgt, habe diese ganzen Kindermotive entfernt und dann praktisch aus Strichfilm neue Walzen selber hergestellt. Das sind alles Textmotive: Es sind im Grunde genommen Texte, die eine Art Loop bilden: Dadurch, dass die Walze im Kreis läuft, fängt der Text immer wieder von vorne an. Das Ganze haben wir als Edition realisiert, und da gibt es eine ganze Menge von verschiedenen Motiven. Ab und zu mal sind Probleme aufgetreten. Ich habe diese Walzen mit doppelseitigem Tesaband zusammengeklebt, da hat sich manchmal das Tesaband gelöst, aber das kann man dann austauschen. Funktioniert ganz gut, und zur Not kann man diesen Strichfilm auch noch mal neu belichten.
EGC: Wie hoch ist die Auflage?
HB: Ich habe es nicht genau im Kopf, so um die zehn für jedes Objekt. Außer den Lichtmühlen gibt es von mir noch wesentlich größere Leuchtobjekte. Ich habe hier in Offenbach mit der Firma Nordlicht einen sehr, sehr guten Partner gefunden. Nordlicht realisiert viele meiner Arbeiten, auch wenn die zum Beispiel gar nichts mit Licht zu tun haben. Nordlicht ist eine Firma, die im Bereich Außenwerbung aktiv ist, also diese ganzen großen Schriften, die man oben auf Häusern sieht. Sie arbeiten europaweit, und die Firma ist auf vielen Ebenen interessant: Sie haben eine sehr, sehr gute Aluminiumschlosserei. Dann haben sie eine Neonglasbläserei, sie können Plexiglas in jeder denkbaren Art verarbeiten, sie haben eine große Computerfräse und sie haben einen Schneideplotter. Also ich schneide zum Beispiel die Folien für meine Glasfenster auch bei denen. Es ist eine extrem tolle, zuverlässige Firma, die sich jetzt in meinem Fall immer etwas anpassen muss: Deren Arbeiten, wie große Leuchtreklamen, werden normalerweise aus 50, 100 m Entfernung angeguckt, und ich musste sie daran gewöhnen, so genau zu arbeiten, dass man sie aus 5 oder 10 cm Entfernung gut anschauen kann. Das haben sie aber sehr schnell begriffen, weswegen ich eben ständig mit ihnen Projekte realisiere. Wir haben vor ein paar Jahren eine große Arbeit verwirklicht, die von der IG Metall in Nürnberg beauftragt war. Die wollten ein Denkmal haben für politisch verfolgte Gewerkschafter und hatten sich da zunächst eher so eine Käthe Kollwitz-artige Geschichte vorgestellt. Ich konnte sie dann überreden, eine Art Aktion anzugehen: Wir haben auf den Dächern dreier Häuser am Kornmarkt in Nürnberg große Metallschienen angebracht, und auf diesen Schienen konnten modular riesige, rote Buchstaben befestigt werden. Die Idee war, auf diesen Häusern die Namen von politisch verfolgten Gewerkschaftlern in diesen roten Buchstaben zu platzieren, so lange, bis man sie durch Aktionen aus dem Gefängnis befreit hat.
Das heißt, man hat sich selbst immer einen gewissen Druck, einen gewissen Öffentlichkeitsdruck gegeben, und es gab dazu begleitend eine Website, die ich konzipiert und gestaltet habe. Das Angebot der Gewerkschafter war, dass sie mit Betriebsgruppen dafür sorgen wollten, sehr viele Aktionen anzufachen, um die Leute in Thailand, in der Türkei oder wo auch immer aus dem Gefängnis zu holen. Das hat dann zunächst mal auch geklappt mit einer Person. Doch dann haben die Kräfte bei der Gewerkschaft schnell nachgelassen und irgendwie waren sie auch ohne Aktivität ganz zufrieden und wollten nicht ständig dafür arbeiten. Das Projekt ist dann langsam eingeschlafen und diese Namen befinden sich heute immer noch auf den Gebäuden und sind jetzt eher so ein Mahnmal für bestimmte Versäumnisse.
EGC: Und wie hieß das Projekt in Nürnberg?
HB: Das hieß Mayday. – »Mayday« ist ja gleichzeitig ein Hilferuf, es ist aber auch der erste Mai, weswegen sich so die Gewerkschafter gut damit identifizieren konnten.
Mit farbigen, beleuchteten Plexiglasbuchstaben habe ich dann eine weitere Installation gemacht in einem Treppenhaus der Norddeutschen Landesbank, einem Gebäude von Günther Behnisch in Hannover. Da gibt es über sechs, sieben Stockwerke ein Treppenhaus, das in der Mitte eine Öffnung hat, und wir haben dort von oben nach unten vier Sätze buchstabiert in verschiedenen Farben. Diese Sätze bestehen aus einzelnen, mit Leuchtstoffröhren illuminierten Plexiglasbuchstaben. Das Ganze hat eine unglaubliche Präsenz. Es gibt bestimmte Zeitintervalle, in denen solche Anlagen gewartet werden müssten. Man geht davon aus, dass bei einer normalen Brenndauer zum Beispiel diese mundgeblasenen Leuchtstoffröhren alle sieben Jahre neu mit Gas aufgefüllt werden.
EGC: Und wer hat die geblasen, diese Röhren?
HB: Das hat Nordlicht gemacht.
EGC: Hat alles Nordlicht gemacht?
HB: Ja, ja. Und das war auch eine riesen-statische Konstruktion. Sie haben das alles komplett schlüsselfertig reingebaut, und wirklich 1 A, ohne dass ich da einen Zentimeter hätte beanstanden müssen. War ganz toll, ja! Eine andere Arbeit auf der Basis von Leuchtkästen knüpft an die Shaped Canvas-Arbeiten aus den 80er Jahren an, bei denen ich Logos abstrahiert und dann in so einer Art Relief-Form auf die Wand gebracht habe. Ich habe das mit digitalen Mitteln in Reinheitssymbolen wiederholt, wie man sie auf Verpackungen von Waschmitteln findet. Interessiert hat mich dabei eine bestimmte Ikonographie, die in der Hauptsache im 16., 17. Jahrhundert verwendet wurde, als es Leute gab, wie zum Beispiel den Engländer Flut oder den Deutschen Athanasius Kircher, die versucht haben, in Form von Diagrammen die Komplexität der Zusammenhänge unserer Welt oder unseres Seins zu fassen. Da diese Jungs sehr gläubig waren, haben sie natürlich immer auch versucht, ein Bild für Gott zu finden: Sie waren aber schon so weit, dass sie keinen alten Mann mit einem weißen Bart darstellen wollten, sondern sie haben das Göttliche immer in Form von Strahlenmotiven oder leuchtenden Sternen in ihren Diagrammen integriert. Mich hat interessiert, dass genau diese Ikonographie von unseren Waschmittelfirmen übernommen wurde, und dass diese damit auf ihren Packungen arbeiten. Ich habe die ganzen typografischen Elemente der Packungen entfernt, und wir haben dann diese Reinheitssymbole noch mal am Rechner nachgebaut und in Form von Leuchttransparenten auf der Basis von Cibachromes realisiert.
EGC: Aus Diamaterial?
HB: Genau. Das sind große Dias, die vor einem Leuchtkasten schweben. Wir haben gerade darüber gesprochen, da kann man natürlich davon ausgehen, dass die nur eine gewisse Lebensdauer haben und dann müssen sie neu geprintet werden. Im Moment hängen vier davon zum Beispiel bei der Deutschen Bank in Frankfurt in einer Situation, die einen sehr, sehr starken Tageslichtanteil hat, da habe ich ein bisschen Bammel, wie sich das entwickelt.
EGC: Aber es ist reproduzierbar?
HB: Ja, ja. Es gibt natürlich die Dateien und man kann es wieder printen. Und dann gibt es eine Serie, wieder mit einem sehr stark politischen Inhalt, die nennt sich Food, das ist ein sehr großes Konvolut von Leuchtkästen, die zusammen eine sehr, sehr große Wand bilden. Ich habe sie vor einiger Zeit in der Kunsthalle Mannheim gezeigt. Es sind weiße Plexiglaskästen, die auf den ersten Blick aussehen wie die Bestellliste eines Fast Food-Restaurants. Was so ein bisschen irritierend ist, ist, dass bei diesen verschiedenen Fast Food-Gerichten immer über jedem Menü ein Name in einem orangefarbenen Feld steht. Irgendwann kommt man darauf, dass es sich hier um letzte Mahlzeiten handelt. Ich habe hierzu eine Recherche gemacht, auf der Basis von Informationen aus amerikanischen Gefängnissen, und habe mit dieser Arbeit eine Dokumentation geschaffen, bei der man sieht, was zum Tode Verurteilte gegessen haben, kurz vor dem Moment, in dem man ihnen die Lebensberechtigung über den elektrischen Stuhl oder über eine Giftspritze entzogen hat. Dazu gibt’s noch eine Dokumentation in Form von Ordnern und Datenblättern. Das ist eine Arbeit, die auf den ersten Blick ganz souverän und aufgeräumt rüberkommt, aber sie kann einem schon ganz schön den Boden unter den Füßen wegziehen.
EGC: Es ist quasi ein Verzeichnis der Henkersmahlzeiten?
HB: Ja, und um da vielleicht noch mal was zur Technik zu sagen: Es ist weißes Plexiglas mit Leuchtstoffröhren darin, und hier haben wir die Typografie mit Folien draufgegeben. Die Folie ist nach Dateien ausgeplottet und man kann auch davon ausgehen, dass das eine begrenzte Lebensdauer hat. Man kann aber auf der Basis von den Dateien, die es gibt, diese Folie immer wieder neu auftragen auf die Kästen.
EGC: Okay.
HB: Aber da gibt es jetzt auch relativ wenig Erfahrungswerte, wie lange das hält, das muss man beobachten, also möglicherweise ist das auch dann ganz gutmütig und hält 50 Jahre und sieht dann noch halbwegs gut aus, aber für den Notfall gibt’s die Dateien.





EGC: Sind die im Moment irgendwo installiert und brennen, oder dienen sie bei Dir auf dem Lager?
HB: Nein, die waren eine Zeit lang in Mannheim zu sehen und wurden dann eingelagert. Ich glaub, die sind jetzt gerade in Düsseldorf in einem Lager. Bemerkenswert an dieser Arbeit ist die Riesenmenge an Licht, die sie abstrahlt, so dass sich in der Kunsthalle die komplette Lichtsituation verändert hat. Auch in Zonen, in denen man gar nicht mehr diese Kästen direkt gesehen hat, gab es ein anderes Licht als vorher. Das hat eine unheimliche Energie entfacht, und wir haben dann nur die Hälfte der Lampen eingeschaltet, weil es einfach zu massiv war. Das hätte alles andere weggeblasen im Museum (lacht). Gut, dann gibt es noch ein Leuchtkastenprojekt, das ich auch mit der Firma Nordlicht produziert habe. Ich hatte eine Einladung vor ein paar Jahren, zur Kunstmesse in Köln eine Lounge für junge Sammler zu gestalten. Ich habe mich da mit einem Phänomen beschäftigt, über das ich immer wieder nachdenke und über das ich auch mit vielen Leuten spreche: Es ist ja so, dass man am Ende seiner Teenie-Zeit oft sehr selbstbewusst Entwürfe fürs Leben formuliert, große Pläne hat, und es ist ein großer Unterschied, wenn man nach 10, 20 Jahren vergleicht, was sich aus diesen Ideen entwickelt hat. Meistens ist nicht mehr sehr viel übrig. Die Differenz von Traum und Wirklichkeit ist oft eine sehr traurige Geschichte. Ich habe eine Reihe von Leuchtkästen konzipiert, die genau so aussehen wie Kästen, mit denen für Filme an Kinos geworben wird, und habe dann fiktive Filmtitel entwickelt, die sich von den Texten her sehr stark auf verschiedene Bereiche der Jugendkultur beziehen.
Es gibt einen Titel, der sich auf einen James Dean-Film bezieht, es ist aber nicht der Titel des Films. Es gibt einen Titel, der Guy-Ernest Debord zitiert, dem Gründer der Situationistischen Internationalen, oder es gibt ein Zitat von Malcom McLaren. Weiterhin gibt es Anklänge an verschiedene Popmusiktitel. Teilweise sind die Texte auch von mir selbst formuliert. Wir haben damals aus diesen Leuchtkästen einen ganzen Raum gebaut. Die Kästen werden aber inzwischen auch alleine gehandelt.
EGC: Und welcher Anlass war für die Installation gewesen?
HB: Auf der Kunstmesse in Köln gab es einen Bereich, in dem junge Galerien vorgestellt wurden. Daran angeschlossen, war eine Lounge, die habe ich gestaltet.

EGC: Heiner, jetzt kommen wir zu verschiedenen Objekten. Wie würdest Du die Arbeitsgruppe hier jetzt nennen?
HB: Als Übertitel haben wir sie Kinetische Objekte genannt. Das habe ich nie so genannt, das ist eine Begrifflichkeit aus einer anderen Zeit. Auf der anderen Seite kann man eine ganze Reihe von Werken unter so einem Titel fassen, also diese Objekte, die sich in irgendeiner Form bewegen, die kommen immer wieder vor bei mir. Die haben auch wieder sehr stark zu tun mit diesen Reflexionen über Zeit, und als erstes haben wir hier notiert: John Crawford Striches A Pose, das ist ein Objekt, bei dem es um die Darstellung von Zeit mittels Sanduhren geht. Das ist so eine Art Speichenkonstruktion mit zwölf Armen, an jedem Arm hängt eine Sanduhr dran, und das Ganze ist doppelkugelgelagert. Es gehört dem ZKM in Karlsruhe. Die ganze Geschichte ist eigentlich so gedacht, dass man das als Betrachter drehen lassen soll, das macht unheimlich Spaß, weil da immer dieser Sand von der einen Sanduhrhälfte in die andere rinnt. Es dreht sich unglaublich lange.
Ehrlich gesagt, hatte ich so insgeheim die Hoffnung gehabt, ich hätte vielleicht das Perpetuum Mobile erfunden, aber es hat nicht ganz funktioniert (lacht). Diese Sanduhrgeschichte hat mich sehr beschäftigt, weil es natürlich eine ganz alte Art der Zeitdarstellung ist und man eben auch so mit begrenzten Zeitmengen arbeitet. Es gibt ein ganz tolles Buch von Ernst Jünger, das nicht wirklich bekannt ist, über Sanduhren, das auch bestimmt mit zu dieser Arbeit beigetragen hat. Obwohl es wie viele meiner Arbeiten sehr einfach aussieht, war es relativ aufwändig das Objekt zu produzieren. Die Stahlkonstruktion war noch das Einfachste, da muss man vielleicht nur dazu sagen, das ist roher Stahl, bei dem ich den Rostflug abgeschliffen habe, dann habe ich’s mit einem Mattlack lackiert. Man sollte darauf achten, dass es nicht anfängt zu rosten, aber es war mir wichtig, dass es dieses direkte Material ist. Die Taillen der Sanduhr, die habe ich drehen lassen, auch das war noch relativ einfach, aber es war so zu der Zeit schwierig, einen Glasbläser zu finden, der mir diese Gläser bläst, in denen sich der Sand befindet.
Ich habe zuerst in der damals sich im Auflösezustand befindenden DDR in Lauscha geguckt, da gibt es eine große Glasbläsertradition. Ich hatte aber das Problem, dass die Leute dort nicht gelernt hatten, präzise zu arbeiten. Da sah praktisch jedes Glas anders aus, und ich bin dann bei einem Glasbläsermeister in Zwiesel gelandet, und der hat nach einer Zeichnung von mir wirklich perfekt gearbeitet. Ich habe mehr Gläser habe herstellen lassen, als ich gebraucht habe, so dass das ZKM noch Ersatz hat. Ein ganz, ganz schwieriges Thema war der Sand, da kann man nicht jeden Sand nehmen. Das muss ein Sand sein, der ein sehr rundes Korn hat, und den habe ich damals über jemanden aus Lauscha bekommen. Das war ein Sand aus einem militärischen Sperrgebiet, wo jemand einen Kumpel hatte, der Zugang hatte, und der hat diesen Sand ausgegraben. Ich habe es auch nie genau rausgekriegt, wo der herkam, aber es ist tatsächlich ein Sand, der sehr gut rieselt und eine schöne Farbe hat. Das wäre bestimmt für einen Restaurator ein Riesenproblem, diesen Sand wieder aufzutreiben. Das ist dann wahrscheinlich so eine halbe Doktorarbeit, die dann ansteht (lacht).
EGC: Wer hat für Dich diese Eisenkonstruktion und die Mechanik ausgeführt? Ist die Arbeit zurzeit installiert?
HB: Nein. Die Karlsruher haben die Arbeit im Moment nicht installiert. Die haben auch diese Hände. Das hat damals noch Heinrich Klotz gekauft. Dieter Daniels hat ihn damals beraten, ein guter Typ. Ja, also, die Metallkonstruktion habe ich mit der Bauschlosserei »ATW« in Frankfurt-Bockenheim gemacht, wo ich damals meine Wohnung und mein Atelier hatte. Das ist aber eine ganz solide Arbeit.
EGC: Hast Du öfters mit dem zusammengearbeitet?
HB: Sehr oft, ja. Zu der Zeit, da gab es einen ganz tollen Handwerksmeister, so ein bulliger, rothaariger Typ, der kurz vor der Pensionierung war, und der hatte immer großen Spaß, sich in meine Spinnereien reinzuschaffen. Alles wurde stets ganz präzise ausgeführt, das war großartig mit dem zu arbeiten. Und als er dann in Pension war, habe ich mit der Firma auch nicht mehr so viel anfangen können. Das sind immer ganz bestimmte Personen, die da auch ein Gefühl für die künstlerischen Feinheiten entwickeln können.
EGC: Jetzt kommen wir zu einer anderen Objektinstallation, Milch holen, Hinweg von 1995, mit einem motorgesteuerten Seilbahnroboter. Wie entstand die Idee zu diesem Roboter?
HB: Die Idee kommt aus der Beschäftigung mit einem Mann aus dem Mittelalter: Villard de Harnoncourt. Das ist ein Mensch gewesen, der an einer Bauhütte gearbeitet hat. Er hat ein Skizzenbuch geführt und in diesem strichmännchenartige Zeichnungen gemacht: Figuren, wie aus Modulen zusammengebaut. Es gab dann in der Renaissance auch einen anderen Künstler, Luca Cambiaso, über ihn gab es tollerweise letztes Jahr in Osnabrück eine Ausstellung, bei der auch meine Arbeit gezeigt wurde, er hat auch Figuren aus Segmenten zusammengesetzt, so dass die aussahen wie Roboter. Solche abstrahierten Figuren haben mich sehr beschäftigt, und ich wollte unbedingt so etwas bauen, aber eben in einer beweglichen Form. Darüber, außer dass ich das aus Dosen bauen wollte, habe ich mir nicht groß Gedanken gemacht. Möglicherweise kommt das daher, dass ich als Kind gerne die Augsburger Puppenkiste gesehen habe, und da gab es eine Blechdosenarmee, die immer den Berg runtergerollt ist. Das hat mich sehr beeindruckt, denk ich mal. Das war eine sehr große Anstrengung, diese Skulptur zu realisieren. Wenn wir bei der Figur anfangen, ist die praktisch die Hälfte von meiner Körpergröße. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich gerne mit Körpermaßen arbeite. Für die Realisierung habe ich einen jungen Schlossermeister gefunden, der sich da sehr reingeschafft hat. Zuerst habe ich gedacht: Na gut, man nimmt irgendwelche handelsüblichen Blechdosen, holt dann die Lebensmittel raus und verschließt sie wieder. Da ich aber großen Wert auf Proportionen lege, habe ich nichts Zufriedenstellendes gefunden. Ich habe mir von einer Blechdosenfertigung verschiedene Deckelgrößen besorgt und habe dann diese Deckel auch verwendet. Die Körper von den Blechdosen haben wir selber hergestellt, und zwar in einer Firma für Lüftungsbau, die die nötigen Werkzeuge hatten, und in diesen Blechdosen habe ich Rillen einprägen lassen. Für diese Rillen haben wir ein Extra-Werkzeug angefertigt, weil ich eine ganz bestimme Vorstellung hatte über die Tiefe und Winkelung (lacht). Das ist total verrückt, da wurde praktisch extra ein Werkzeug gedreht, mit dem wir diese Rillen rein gedreht haben, und obwohl es nur ein paar Dosen waren, war das unglaublich stressig.
EGC: Sieht aus, als ob es ein Halbzeug gewesen wäre, das Du hierfür verwendet hast, also ein Material, das in der Industrie so vorgefertigt wird. Aber so ist das ja unglaublich aufwändig.
HB: Ja, ja. Gut, dann hat der Schlosser mir diese Dosen zusammengebaut, sie waren aus Stahlblech, und die Idee war, die Dosen zu verzinken. Wir haben sie in eine Galvanisieranstalt gebracht und, woran wir nicht gedacht hatten: Es entstand das Problem, dass dadurch, dass die Dosen hohl waren, sie einen irrsinnigen Auftrieb hatten und in diese galvanischen Bäder immer nach oben schwammen. Dann haben wir Löcher hineingemacht, damit man die Dosen versenken konnte, es hat aber nicht richtig funktioniert. Also, die sahen aus wie Sau. Und dann habe ich mich schweren Herzens entschlossen, die Dosen zu lackieren. Ich bin nach Frankfurt zu MVG, ein guter Handel für Metalle, gefahren und habe mir ein Spray geholt, einen Imitationslack für galvanische Oberflächen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was für eine Sorte das war, die haben da verschiedene Sprays zur Imitation von Chrom oder Nickel oder anderen galvanischen Oberflächen. Damit habe ich die Figur lackiert. Ich muss sagen, ich bin jetzt von der Optik her damit sehr zufrieden, habe aber immer so ein bisschen das Problem, dass ich das Gefühl habe, das ist geschummelt, weil es nicht wirklich wie eine Dose hergestellt ist.
EGC: Eine Camouflage.
HB: Ja, aber es war einfach das Beste, was man damals machen konnte aus der Situation. Gut, an diese Dosen wurden dann verschiedene Gelenke angeschweißt, und das war dann wiederum alles sehr handhabbar. Was natürlich auch eine Riesenoperation war, war dieser Seilbahnmechanismus. Und ich habe rumgefragt und in Frankfurt niemanden gefunden, dem ich das zugetraut hätte, und dann bekam ich den Tipp für eine Firma in Butzbach, die hatte so einen seltsamen Namen gehabt, die hießen, glaube ich, »Lernbetriebe Metall«, und deren Hauptaufgabengebiet war es, Kinderspielplatzgeräte herzustellen. Die hatten einen ganz fantastischen Ingenieur, ein richtiger Erfinder, ein sehr sympathischer Typ, der für die Firma intern Maschinen gebaut hat, die Dinge konnten, die handelsübliche Maschinen nicht konnten. Und dieser Typ hat die Herausforderung angenommen und dann mit relativ einfachen Mitteln mit mir zusammen diese Konstruktion gemacht: Es sind zwei Wandhalterungen, da haben wir mit einem kleinen Duchamp-Verweis, mit Fahrradspeichenrädern gearbeitet. Er hat eine Führung integriert für zwei Stahlseile und hat ein sehr cleveres Konzept gemacht, wie der Strom zur Figur geführt wird und wie sich diese ganze Puppe bewegt. Also, es ist unheimlich schön durchdacht und das Interessante ist eben, dass wir die Figur durch diesen Mechanismus immer wieder an unterschiedlichen Orten aufbauen können. Man braucht zwei gegenüberliegende Wände und zwei Stahlseile in der passenden Länge, an denen die Puppe läuft. Es gibt ein bestimmtes Maß, das sollte man nicht überschreiten, weil dann das Seil zu sehr durch hängt, dann funktioniert das nicht mehr. Weiterhin hat man das Problem, dass man, wenn man die Geschichte aufgebaut hat, dieses Stahlseil spannen muss. Da ist eine unglaubliche Spannung drauf, und wir hatten jetzt beim letzten Aufbau in Osnabrück das Problem, dass die Museumsleute total Angst gekriegt haben in ihrem Altbau, dass wir die ganze Wand umreißen durch diese Spannung (kichert). Wir haben es dann mit einer Hilfskonstruktion ganz gut hin bekommen. Aber es ist schon eine Operation dieses Ding aufzubauen, doch es ist zum Glück so gut durchdacht und so nachvollziehbar, dass man es, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, hinbekommt.
EGC: Ist die Arbeit noch in Deinem Besitz?
HB: Die ist im Besitz der Galerie Grässlin. Obwohl sie relativ oft gezeigt wurde, ist sie noch nicht verkauft.
EGC: Jetzt kommen wir zu der Gruppe der Uhren, Flüssig, bestehend aus 13 verschiedenen Objekten.
HB: Das Projekt Flüssig entstand ursprünglich als eine Kunst am Bau-Arbeit für die Dresdner Bank in Frankfurt. Die Bank wollte im Bahnhofsviertel für jede Etage eines ihrer Gebäude ein Objekt, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, in welcher Etage sie sich befinden. Es war die Art von Architektur, bei der, egal wo man war, man das Gefühl hatte, man ist hier schon mal gewesen und kennt sich trotzdem nicht aus; das hatten die relativ gut erkannt, dass das so nicht geht (lacht). Die Aufgabe war, eigentlich nur etwas zu gestalten, um zu wissen: Okay, hier war ich schon mal, oder hier muss ich hin, das ist mir vertraut. Ich habe für jedes Stockwerk eine Uhr gebaut, relativ groß: im Durchmesser etwas über einen Meter und habe dann eine ganze Werkgruppe daraus gemacht, weil mir mehr Uhren eingefallen sind, als es Etagen gab. Diese ganze Werkgruppe heißt Flüssig, weil natürlich dieses Bild des Flusses in der Philosophie über die Zeit, man muss ja nur an Heraklit denken, eine ganz wichtige Rolle spielt. Außerdem ist es so, dass es im Frankfurter Bahnhofsviertel ganz viele Straßen gibt, die nach Flüssen benannt sind und noch dazu kam, dass es bei der Ausstellung »Bilderstreit« in Köln eine Installation von On Kawara gab mit seinen Datumsbildern in einem Raum, mit einer großen Fensterfront zum Rhein hin, und das hat mich sehr nachhaltig beeindruckt.
Das war sehr, sehr schwierig, diese Uhren zu bauen, da die Art, wie ich mir die Uhren vorgestellt habe, nicht den Normen entsprach, nach denen eben normalerweise Uhren konstruiert werden. Nach einer relativ langen Odyssee bin ich schließlich bei einer Turmuhrenfabrik in der Nähe von Bielefeld gelandet. Ich habe es zuerst im Schwarzwald probiert, die hatten aber alle nur noch mit Fertiguhrwerken aus Fernost gearbeitet. Da gab es niemanden mehr, der sich da reingeschafft hätte. Diese Turmuhrenfabrik, das waren Leute, die es einfach gewohnt waren, in großen Dimensionen zu arbeiten. Was man nicht unterschätzen darf, ist das Problem, dass man von dem Mittelpunkt des Zifferblatts aus bei den Zeigern mit einem irrsinnigen Hebel rechnen muss, den man in irgendeiner Form präzise austarieren muss. Je länger und je unförmiger der Zeiger wird, um so schwieriger wird es, eine vernünftige, präzise gehende Uhr zu konstruieren.
EGC: Aus welchen Materialien bestehen die Uhren?
HB: Es gibt ein einheitliches Gehäuse für alle Uhren, das aus Stahlblech besteht. Den Kasten habe ich in einer Autolackierwerkstatt lackieren lassen, das ist ein silberner Autolack, der für ein französisches Auto, einen Citroën, verwendet wurde. Dann gibt es im Innenteil diese ganzen Zifferblätter und Anzeigeelemente, die sind weitgehend aus Aluminium, die habe ich von einer Firma mit einer Computerfräse aussägen lassen. Diese Elemente wurden auch lackiert und teilweise mit Siebdruck bedruckt. Die Uhrwerke wurden komplett von der Turmuhrenfabrik Korfhage gebaut. Die Uhren verfügen alle über eine Funksteuerung, das heißt, man muss die nicht immer stellen, sondern sie stellen sich von selbst.
EGC: Ist ja unglaublich. – Und die wurden dann auch installiert?
HB: Ein Großteil der Uhren wurde dann installiert, und die anderen kamen über die Galerie Grässlin in den Handel. Und, es gibt eine Uhr, die ich kurz erwähnen möchte, weil da ein Schaden aufgetreten ist. Das habe ich neulich bemerkt. Die befindet sich in der Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart. Diese Uhr ist so gebaut, dass es statt Uhrzeiger verschieden große weiße Scheiben gibt, die sich übereinander befinden. Die oberste Scheibe ist kleiner als die Scheibe, die darunter liegt, und die unterste Scheibe ist dann die größte. Diese Scheiben sind makellos weiß lackiert und drehen sich als Sekunde, Minute und Stunde. Dadurch, dass sie sehr perfekt produziert sind, sieht man das kaum, da muss man sich irgendwo ein kleines Staubkorn suchen, das sich auf einer Scheibe befindet, und dann kann man sehen, dass sich das dreht. Das ist natürlich der Witz bei der ganzen Angelegenheit. Als ich das letzte Mal das Objekt gesehen habe, habe ich bemerkt, dass sich bei der obersten Scheibe am Haltemechanismus, der die Scheibe mit dem Uhrwerk verbindet, eine kleine Bruchstelle gebildet hatte, so dass man da jetzt relativ deutlich sieht, dass die Scheibe sich bewegt. Das ist etwas, das kann man relativ schlecht im Detail restauratorisch in den Griff kriegen. Eine in der Spritzkabine lackierte Platte mit einer punktuellen Retusche so hinzukriegen, dass die Oberfläche perfekt ist, halte ich fast für ausgeschlossen. Insofern muss man sich wahrscheinlich die ganze Platte vorknöpfen, stabilisieren und dann noch mal neu lackieren. Dann gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, dass man genau den Ton der anderen Platten treffen muss. Eventuell sollte man dann alle Platten noch mal lackieren, um eine Einheitlichkeit hinzubekommen.
EGC: Weil sich die Farbe an sich ja auch schon verändert hat.
HB: Ja, ja. Selbst wenn ich jetzt angeben würde, es ist die Farbe Citroën so und so, durch die Zeit hat sich das jetzt so verändert, da kann man jetzt auch nicht mehr auf die ursprüngliche Farbnummer zugreifen, das muss man eigens anmischen.
EGC: Hast Du ein Feedback bekommen, zu der Installation in der Dresdner Bank?
HB: Von den Leuten, die da unterwegs sind?
EGC: Von den Leuten, ja?
HB: Ja, ich habe in solchen Kontexten einen sehr großen Ehrgeiz, nicht nur etwas zu machen, was jetzt mich befriedigt oder einen Kunstkritiker, sondern ich möchte eigentlich immer, dass die Leute sich mit diesen Arbeiten auch wohl fühlen. Dieser Anspruch ist eigentlich genau in dieser Zeit entstanden, weil ich von den Mitarbeitern auch teilweise ein kritisches Feedback bekommen habe, was den Grund hatte, dass sie sich, sagen wir mal, als Leute, die in einer Bank arbeiten, sowieso in so einer Mühle befinden, und sie fühlten sich von diesen großen Uhren zum Teil ein bisschen so unter Druck gesetzt. Manche fühlten sich auch ein bisschen veralbert, daran kann ich mich noch genau erinnern: Es gibt eine Uhr, bei der alles um eine halbe Stunde versetzt ist; es gibt praktisch keine graden Stundenzahlen, sondern immer eine halbe Stunde später, und da haben sie sich so ein bisschen gefoppt gefühlt. Aber genau das hat mir eigentlich großen Spaß gemacht, weil es genau diesen Punkt getroffen hat, den ich eigentlich auch angreifen wollte: diese deutsche Präzision, damit sind sie überhaupt nicht zurechtgekommen.
EGC: Und die laufen nach wie vor noch da?
HB: Ich geh mal davon aus. Es ist so, dass diese Turmuhrenfabrik so eine Anlage warten kann, deswegen ist es natürlich super, so eine Firma im Boot zu haben. Darauf sollte man achten, wenn man solche empfindlichen Arbeiten baut, dass man auch einen Ansprechpartner hat, der für Reparaturen zur Verfügung steht, und nicht, dass man dann als Künstler, der eigentlich keine Ahnung von Uhrenmechanik hat, plötzlich vor der Aufgabe steht, so eine Uhr reparieren zu müssen. Auch ein normaler Restaurator ist ja kein Uhrmacher. Auf solche Dinge habe ich in der Folge verstärkt geachtet, dass, wenn jemand so eine Arbeit von mir kauft, er dann auch auf der sicheren Seite ist.






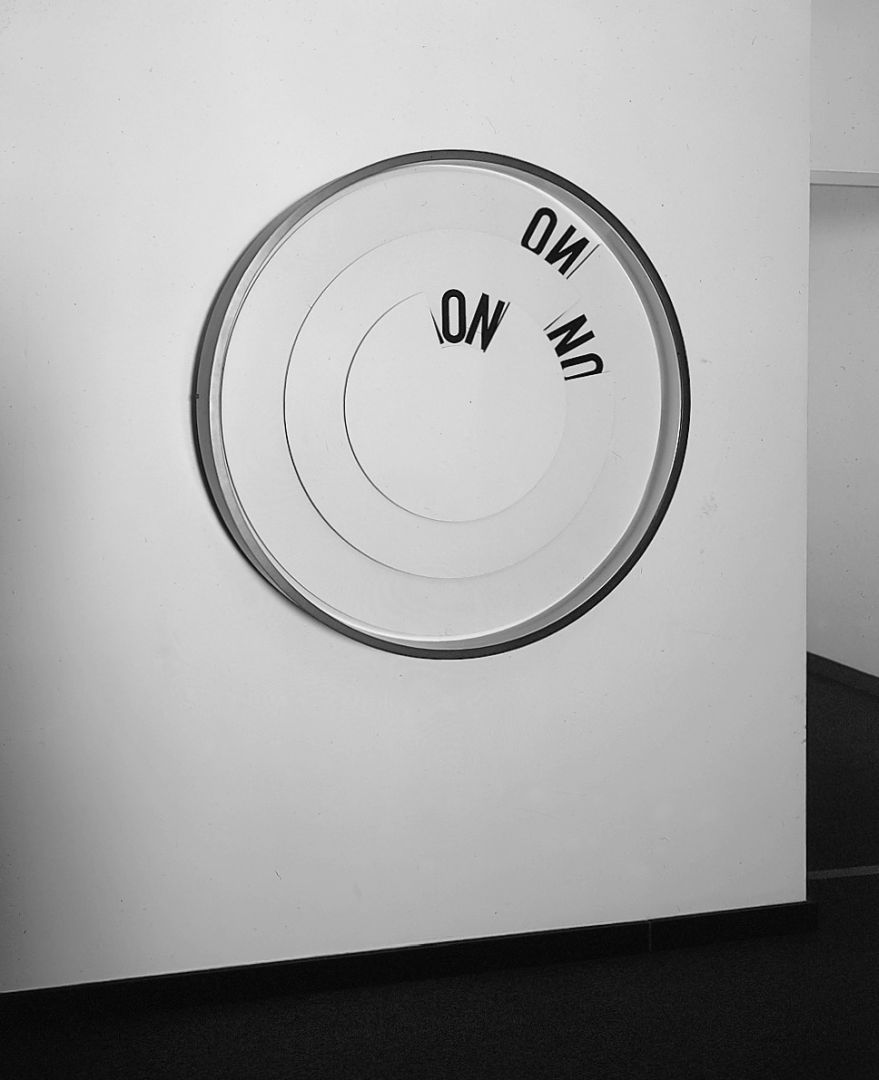


EGC: Machen wir jetzt bei den Mirrorballs weiter, Heiner.
HB: Wie man weiß, bin ich jemand, der stark an Clubkontexten interessiert ist. Und natürlich hat mich, wie viele andere Künstler auch, diese Ikone der Discokultur sehr stark beeindruckt: die Discokugel, die aus vielen kleinen Spiegelelementen besteht. Ich habe meine eigene Version gebaut, auf der Basis einer ganz einfachen Aluminiumkonstruktion. Ich habe einfach zwei Kreise aus Aluminium ausschneiden lassen, dann wurden die zur Hälfte geschlitzt, ineinandergesteckt und dann noch mal miteinander verschweißt. Diese ganz rudimentären Kugeln habe ich schwarz lackiert und daran dann mit einer Halterung Spiegel befestigt. Auf diese Spiegel wurde eine Plotterfolie kaschiert, auf der man spiegelverkehrt ein Wort lesen kann. Das Ganze wird in die Mitte eines Raumes gehängt, und in den Ecken befinden sich so genannte Dedo-Lights, das sind Effektbeleuchtungen, die man für Filmsets verwendet, wenn man wenig Platz hat. Die können über eine Optik ein fokussiertes Licht erzeugen, wie ein Diaprojektor oder wie ein Verfolger. Das Licht wird aus vier Ecken auf die Kugel projiziert, und die Kugel dreht sich mit einem Discokugelmotor. Das Interessante ist natürlich, dass die Schrift auf die Wände des Raums geworfen wird. Es befinden sich an jeder Kugel drei bis vier von diesen Textspiegeln. Der Raum wird dann erfüllt von diesen Schriften, die sich bewegen. Das Spannende ist, an bestimmten Stellen überkreuzen sich die Schriftzüge in der Bewegung. Ich habe hierbei nicht mit normalen, sondern mit oberflächenverspiegelten Spiegeln gearbeitet, so wie man sie zum Beispiel von einer Spiegelreflexkamera kennt. Weil es natürlich beim Spiegel das Problem gibt, wenn man ihn, so wie ich jetzt, als Projektions-Schablone benutzt, er einmal an der Glasoberfläche reflektiert und einmal an der Glashinterseite, an der sich die Silberschicht befindet: Da hat man immer eine Doppelkontur. Deswegen gibt es eben diese oberflächenverspiegelten Spiegel. Da habe ich mit einer Firma in Berlin zusammengearbeitet, die so etwas für verschiedene optische Zwecke herstellt und habe mir da große Scheiben schicken lassen, die wir dann zugeschnitten haben.
EGC: Die sind sicher sehr kostspielig?
HB: Ja, es geht. Also wenn man das in einer größeren Menge kauft, ist es eigentlich ganz vernünftig und nachvollziehbar im Preis. Bei den Mirrorballs habe ich das erste Mal mit Computer-geschnittener Klebefolie gearbeitet, und auch da muss man natürlich mal gucken, wie sich das jetzt mit der Zeit entwickelt: Wenn es kleine Risse gibt oder so, kann man die ja eventuell noch ausbessern. Aber ich hätte da auch kein Problem, dass man irgendwann die Folie abnimmt und ersetzt. Möglicherweise zerstört man dann aber auch diese Oberflächenverspiegelung und sollte dann vielleicht gleich einen neuen oberflächenverspiegelten Spiegel und eine neue Folie einsetzen.
EGC: Und die Auswahl der Begriffe, die Du hierfür verwendet hast?
HB: Das sind Begriffe, die sehr klar wirken, und gleichzeitig ein größeres philosophisches, existentielles Feld abstecken. Eigentlich kann man sagen, sind es so was wie Gedichte, die aus drei oder vier Wörtern bestehen.
EGC: Und die Arbeit, ist die irgendwo installiert?
HB: Nein, die ist also nirgendwo fest installiert.
EGC: Also sie befindet sich auf dem Lager?
HB: Richtig. Es ist so: Ich habe zwei Varianten von Grundkugeln, eine mit drei Flügeln, eine mit vier Flügeln. Es gibt aber mehrere Sets mit Spiegeln, so dass, wenn ich alle verkaufen würde, ich diese Kugeln noch mal nachproduzieren müsste, damit alle komplett sind.
EGC: Und Du hast auch schon dieses Werk in Installationen oder Ausstellungen mit anderen Stücken kombiniert?
HB: Am Schönsten ist es eigentlich, wenn man einen Raum hat, in dem sich nur diese Installation befindet.
EGC: Aber ich kann mich erinnern, dass ich mal eine Abbildung gesehen hätte.
HB: Genau, es gab mal einen Raum, in dem gleichzeitig der Seilbahnroboter lief.
EGC: Als nächstes möchte ich zur Arbeit Warum sehen die Wolken so verschieden aus? kommen.
HB: Das ist eine Arbeit, die ich realisiert habe für die Landesbank Baden-Württemberg, die hatten ein neues Gebäude bezogen in Stuttgart in der Fußgängerzone, und ich sollte dort im öffentlichen Raum eine Arbeit machen. Architektonisch gab es im Erdgeschoss eine Art Vordach mit einem Hohlraum in der Decke, direkt über den Bürgersteigplatten. Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man dort Gobo-Projektoren einbauen lässt. Gobo-Projektoren werden vorwiegend im Bühnenbereich eingesetzt und sind im Prinzip starke, fokussierte Scheinwerfer, die die Möglichkeit bieten, ein Gobo, das ist so eine Art haltbares und hitzebeständiges Dia, auf eine beliebige Fläche zu projizieren.
Ich habe dann aus meinem Fundus von Fragen, das ist ein Projekt, das ich seit Anfang der 80er Jahre verfolge, was seitdem öfter auch mal von anderen Künstlern aufgenommen worden ist, eine Reihe von Fragen ausgewählt, am Rechner spiralförmig gesetzt und dann rotierend als Gobi projiziert.
Es gibt in Stuttgart ungefähr zehn von diesen Projektoren und es gibt, glaube ich, dreimal so viel Fragen. Die Idee war, dass man die Gobos regelmässig austauscht. Ich habe dann eben für die Gobos mit den Fragen einen Karteikasten gebaut, der sich ebenfalls im Besitz der Landesbank befindet. Das Problem war, dass man diese Gobo-Projektoren sehr sorgfältig warten muss: Es gibt eine bestimmte Brenndauer, die die Lampen haben, und nachdem die Brenndauer abgelaufen ist, muss man sie austauschen, sonst gibt es die Gefahr, dass sie irgendwann Schaden anrichten, im Gehäuse explodieren oder einfach nicht mehr gehen. Leider wurde die Arbeit nicht regelmäßig gewartet, obwohl wir das vereinbart hatten, und irgendwann wurde sie dann stillgelegt. Wartungsintensive Arbeiten sind ein Riesenproblem, das habe ich für die nachfolgenden Projekte immer wieder mit ins Kalkül gezogen. In solchen Kontexten ist es extrem schwierig, pflegeintensive Arbeiten anzubieten. Man hat sehr oft in der Anfangszeit Ansprechpartner, die eine hohe Motivation haben, aber irgendwann haben die andere Sachen zu tun und denken dann einfach auch nicht mehr dran. Das ist oft auch gar keine böse Absicht. Oder man hat sich mit einem Kurator auf eine bestimmte Behandlung einer Arbeit geeinigt und dann kommt jemand anderes, der wieder andere Interessen hat und alles geht den Bach runter. Ich habe in der Folge, wenn ich komplexere Arbeiten realisiert habe, ein größeres Augenmerk daraufgelegt, nicht irgendwas zu machen, was Gefahr läuft, später still gelegt zu werden. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch mit dem Kurator, der die Sammlung in Stuttgart betreut, und wir überlegen jetzt gemeinsam, die Projektion an einem anderen Ort wieder zu aktivieren.
EGC: Wäre ja schön.
HB: Ja, klar (lacht).
EGC: Aber es ist schon verrückt, nicht wahr: Das Schicksal von sehr vielen Installationen, auch Videoinstallationen und so weiter, wird dann besiegelt, wenn es mal zu einer ersten Schwierigkeit kommt. Es ist schon so, wie Du sagtest: Es kommt auf den Einzelnen an und auf die Einstellung gegenüber dieser Art von Kunstwerken, sie am Funktionieren zu halten.
HB: Ja. Es gibt auf der anderen Seite auch in der Ausschreibung von ähnlichen Projekten oft eine Klausel, dass man keine Arbeiten abliefern soll, die eine große Pflege erfordern.
EGC: Das ist doch absurd, oder?
HB: Es ist realitätsnah, würde ich sagen. Ganz viele Ideen, die interessant wären, finden dann nicht statt. Durch so eine Erfahrung weiß ich einfach, dass man da sehr vorsichtig sein muss.
EGC: Also, da ist wirklich ein kreatives Problem-Lösungsverhalten verlangt, das im Vorfeld schon mit in die Überlegungen einzubeziehen ist.
HB: Ja, genau. Und was sinnvoll ist, ich habe das ja vorhin in Bezug auf die Uhren schon gesagt, dass man wirklich eine professionelle Firma im Hintergrund hat, eben wie diese Uhrenfabrik Korfhage, [Korfhage Ed. & Söhne GmbH 6 Co. Turmuhrenfabrik. 4932 Melle-Buer. Anm. d. Red.], die auch den Leuten so etwas wie einen Servicevertrag anbieten kann. Firmen haben ja zum Beispiel auch für ihre Computer oder Kopierer eine Servicefirma, die man anruft, wenn was nicht stimmt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch bei einem Orientierungssystem, das ich für die Deutsche Bank gemacht habe, eine regionale Firma beauftragt, die man immer anrufen kann, die übers Internet in die Anlage reinschauen kann, um zu sehen, ob alles läuft.





EGC: Jetzt kommen wir zu der Installation Einheiten und Einheiten, Mosaik, am Computer generiert, 1997 entstanden, eine Mosaikarbeit im Foyer des Europäischen Währungsinstituts in Frankfurt am Main.Wie sah hier die Entwicklungsgeschichte und in der Folge die technische Entwicklung für diese Arbeit aus?
HB: Das Europäische Währungsinstitut ist ins ehemalige BfG-Hochhaus am Willy-Brandt-Platz in Frankfurt eingezogen, und es gab von der Immobilienfirma die Idee, das Foyer künstlerisch zu gestalten. Die haben einen kleinen Wettbewerb gemacht zwischen Mischa Kuball und mir, den wir dann sehr gemütlich und freundschaftlich angegangen sind, und schließlich wurde mein Vorschlag realisiert. Die Idee war, das Thema Europa so ein bisschen ins richtige Verhältnis zu rücken. Ich war damals ein bisschen genervt von diesem aufkommenden Euronationalismus und habe künstlerisch eine Art Reise durch die Dimensionen unternommen: Die Arbeit besteht aus Motiven verschiedener Dimensionen. Die kleinste Dimension ist eine Abbildung von Molekülen, die nächstliegende Dimension sind, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, menschliche Gesichter. Die nächste Dimension ist eine Karte von Europa, da kommt dann das Europathema vor, und dann gibt es eine Abbildung mit den Planeten unseres Planetensystems. Schließlich gibt es eine Abbildung von einer großen Galaxie. Das Ganze ist technisch gesehen ein Mosaik mit Photoshop in einer relativ groben Pixelauflösung hergestellt haben und jeder Pixel in unserem Photoshopbild bedeutete ein Mosaikstein für die Mayer’sche Hofkunstanstalt, den die dann von Hand gelegt haben.
EGC: Ein Pixel ist gleich ein Stein.
HB: Genau. Nachdem die Zeichnungen fertig waren, haben wir sie 1:1 ausgedruckt und in Murano wurden dann diese Glassteinchen nach meinen Farben hergestellt. Die Sternchen wurden mit der Hand gebrochen und über Monate von Mitarbeitern der Mayer’schen Hofkunstanstalt auf die Ausdrucke gelegt. Die Leute von Mayer haben immer, wenn ein Motiv fertig war, das Ganze ausgelegt. Da gibt es einen großen Raum, extra dafür, und dann bin ich in so einen kleinen Aufzug verfrachtet und an die Decke gefahren worden, um zu sehen, ob das Mosaik so aussieht, wie ich mir das vorgestellt hatte, und dann habe ich meine Änderungswünsche von oben heruntergerufen, und so einzelne Steinchen wurden verändert. Dazu gibt es eine ganz nette Geschichte: Das Mosaik mit der Abbildung von Europa besteht nur aus verschiedenen Blautönen, und die Mitarbeiter von der Hofkunstanstalt hatten sich da einen kleinen Scherz erlaubt: Als ich zur Kontrolle gekommen bin, hatten sie das schon ausgelegt, und es gab in diesem ganzen Meer aus blauen Farben einen knallroten Stein, den sie einfach aus Jux so zwischen reingelegt hatten. Schon als ich reinkam, waren sie am Schmunzeln und waren irrsinnig gespannt, wie ich darauf reagieren würde. Der Witz war, dass ich überhaupt nichts dazu gesagt habe. Ich habe das ganze Bild korrigiert, habe aber eben nie diesen roten Stein erwähnt (lacht). Und die sind fast verrückt geworden, weil sie gedacht haben, das kann doch nicht wahr sein, das muss dem doch auffallen, der muss was sagen! Und erst ganz am Schluss, nachdem wir alles abgesegnet hatten, ich aus der Tür rausgegangen bin, und auch schon nach der Verabschiedung habe ich zu ihnen gesagt: »Der rote Stein bleibt!« (lacht). Da waren sie ganz erleichtert, aber auch sehr verblüfft, und deswegen gibt es diesen einen roten Pixel an der Säule.
EGC: Das heißt, der ist dringeblieben?
HB: Der ist noch drin, ja (lacht immer noch).
EGC: Das ist ja toll (lacht mit)!
HB: Ja, und es gibt eine andere Sache bezüglich des Mosaiks, die mich doch ein bisschen enttäuscht hat, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und zwar habe ich das Mosaik auf dem Computer immer ohne Fugen gesehen. Das heißt, da stoßen die Pixel direkt aneinander, und auch als wir es ausgelegt haben in München, war es genauso. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass wenn man dann diese Mosaiksteine auf die Säule gibt, sich das Gefüge natürlich aufspreizt und dadurch Zwischenräume entstehen. Diese Zwischenräume wurden dann mit einer grauen Füllmasse zugekittet. Dadurch sieht das Bild für mich immer aus, als wäre es hinter einem Schleier. Wir haben dann, weil ich sehr über diese Wirkung enttäuscht, dieses Grau der Fugen teilweise ein bisschen manipuliert, es mal heller und mal dunkler gemacht, damit sich die Flächen einfach besser zusammenziehen.
EGC: Und das wurde mit Farbe und Pinsel gemacht?
HB: Ich glaube, wir haben das mit Schwämmchen gemacht.
EGC: Jetzt wird ja die Europäische Zentralbank bald umziehen.
HB: Ja.
EGC: Und was wird dann damit geschehen?
HB: Da bin ich auch gespannt. Interessanterweise war der Auftraggeber für das Projekt nicht die Europäische Zentralbank war, sondern der Immobilienbesitzer, Köllmann Immobilien. Das heißt, die haben die Besitzrechte, und da ist jetzt die Frage, ob sie sagen, okay, das gehört zum Haus, wir lassen das einfach drin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie sagen, so, wir geben das jetzt der Zentralbank mit. Das ist natürlich offen im Moment, das weiß ich nicht, wie sich das entwickelt. Aber ich hatte immer die Vorstellung, weil ich lange Zeit in Rom gelebt habe, dass irgendwann dieses Hochhaus platt ist und dass diese Säulen dann einfach so auf einem öffentlichen Platz stehen, inmitten von irgendwelchen Trümmern, so wie das Forum Romanum (beide lachen).
EGC: So Säulenfragmente!
HB: Das war eigentlich meine Vorstellung, wie es irgendwann mal weiter gehen wird mit diesen Säulen (lacht).
EGC: Vielleicht kommt es zu einer neuen Arbeit in dem neuen Gebäude der ehemaligen Großmarkthalle. Wäre ja ganz schön.
HB: Die sind ja da ganz schön am Rudern, weil sie keinen finden, der es bauen will. Hast Du das mitgekriegt?
EGC: Nein.
HB: Es gibt ja diesen Coop Himmelb(l)au-Entwurf, und dazu ja auch eine relativ stattliche Summe. Dann haben sie eine Ausschreibung gemacht, doch es fand sich keine Baufirma, die sich zugetraut hat, das zu bauen. Weil Coop Himmelblau sich Dinge ausgedacht hat, die statisch nicht so einfach zu handeln sind. Eine einzige Firma hat trotzdem angeboten und hat aber den Kostenrahmen so derartig überschritten, dass es jetzt im Moment eine Krise gibt, und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es gibt da vielleicht noch eine ganz interessante Anmerkung zu dieser Angelegenheit. Es ist ja so, dass ich sehr viele Kunst am Bau-Projekte realisiere, also oft so zwei, drei in einem Jahr, und, anders als in einem Museum, wo dann ein Schild daneben hängt, wer die Arbeit gemacht hat, ist es den Leuten nicht klar, wer hinter der Arbeit steckt. Mir ist ganz oft schon passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben: »Ich habe das gerade erfahren, dass ja von Dir diese Säulen sind! Ich lauf da jeden Tag vorbei, habe mich immer gefragt, wer das gemacht hat!« Und das ist mit vielen anderen Arbeiten auch so, weil ich die Arbeiten nicht signiere. Ich fände das irgendwie albern, da in so ein Mosaik meinen Namen reinzusetzen. Obwohl ich merke, dass ich da immer wieder Leute ins Schlingern bringe, mache ich das eigentlich sehr konsequent, dass ich diese Arbeiten eben nicht signiere. Es wäre relativ einfach, einen Namen mit einzubauen, zum Beispiel auch bei den Glasfenstern, die ich gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, das hat da nichts zu suchen.
EGC: Ist ja sehr bescheiden von Dir.
HB: Eigentlich ist es nicht als Bescheidenheit gemeint, sondern eher eine formale Geschichte, die ich gut finde. Ich habe auch sonst Arbeiten nie auf der Vorderseite signiert, und wenn, dann nur auf Drängen von Sammlern oder Galeristen hinten drauf. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich in irgendeiner Form etwas mache, was nur aus meiner Vorstellungskraft entspringt, sondern eigentlich sehe ich meine Vorgehensweise immer so, dass ich bestimme Phänomene zusammenfasse, die sowieso in der Luft liegen oder sich auf etwas, wie einen kulturellen Pool, beziehen. Es ist so, dass ich mich als jemand verstehe, der etwas konzentriert und in eine Form bringt, was im Grunde genommen allen gehört. Und deswegen fände ich es albern, das persönlich zu signieren.
EGC: Da stehst Du aber ziemlich alleine in der Landschaft mit dieser Einstellung!
HB: Ja (lacht)? Also, es ist auch so, dass ich zum Beispiel nicht das Gefühl habe, dass Künstler Konkurrenten sind, sondern ich sehe uns eigentlich eher wie einen Pool von Wissenschaftlern, die an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, und bei dem man eben auch zum Beispiel mit Formeln arbeitet, die ein anderer Künstler ins Spiel gebracht hat. Es gibt ja öfter auch mal Querverweise in meinen Arbeiten, zum Beispiel das Schrift-Layout in der Arbeit Warum sehen die Wolken so verschieden aus? bezieht sich natürlich auf eine Duchamp-Arbeit, bei der er eine Schrift spiralförmig angeordnet hat. Bei mir gibt’s immer wieder Verweise, bei denen es darum geht zu sagen: Okay, es ist irgendwie albern, wenn jeder Künstler versucht, für sich selbst die Künste zu erfinden und so zu tun, als hätte er mit allen anderen nichts zu tun. Das ist ja ein System, das nach allen Seiten hin offen ist. Ich habe das vorhin schon erwähnt: Bei dieser Mosaikgeschichte gab es ja quasi so eine Konkurrenzsituation zwischen Mischa Kuball und mir, die wir beide aber nicht in dem Sinne empfunden haben, sondern wir haben beide einen vernünftigen Vorschlag gemacht, haben da immer auch miteinander kommuniziert, und die Auftraggeber haben dann am Schluss das genommen, was ihnen am besten gefallen hat. Ein Künstler, zum Beispiel wie Stephan Huber, der begegnet mir relativ oft bei Kunst am Bau-Ausschreibungen. Wir haben ein vollkommen entspanntes, sportliches Verhältnis, und mal hat er die Nase vorn und beim nächsten Mal wieder ich. Das ist eigentlich eine sehr, ja, schöne, freundschaftliche Dimension in der das Ganze läuft.
EGC: Sehr schön. Ja, »ihr« lebt im Frankfurter Bankenviertel ja auch nicht weit auseinander mit eurer beiden Mosaiken. Er hat ja auch in der HELABA Bank ein Mosaik realisiert.
HB: Ja, da ist das Lustige, dass ich da drauf bin auf diesem Mosaik!
EGC: Ja, ja. Die Größen von Frankfurt?
HB: Das ist eine sehr amüsante Geschichte. Auf diesem Mosaik sind, glaube ich, die 50 wichtigsten Leute, die in Frankfurt gelebt haben. Er hatte mich eines Tages angerufen und wollte mich dabeihaben. Ich war etwas beschämt, weil er mich dazu ein bisschen gezwungen hat. Ich bin der Jüngste, der diese Treppe da runter spaziert. Ich fand das aber auch eine schöne Geste von ihm! Sehr lustig daran ist, dass auf dem Bild von mir nur mein Kopf echt ist; den Körper hat mit einem Modell dazu gebastelt. Das lag natürlich daran, dass er von diesen vielen Leuten aus vergangenen Zeiten oft nur ein Porträt hatte und sich die Körper dazu erfinden musste. Ich hatte ihm dann angeboten, dass mich selber fotografieren könnte mit allem Drum und Dran. Da hat er gesagt: »Nein, nein, das ist nicht notwendig«. Er brauche nur meinen Kopf, Körper mache er selbst (lacht). Und deswegen kann ich mich nur zum Teil identifizieren - mit dieser Figur (beide lachen).
EGC: So, ja, jetzt kommen wir zu Wir und wo.
HB: Wir und wo ist im Grunde genommen fast auch so etwas wie ein digitales Mosaik. Ich hatte damals einen Anruf bekommen von Friedhelm Hütte von der Kulturabteilung der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hatte ein neues Gebäude gebaut, »IBC«, in der Nähe der Frankfurter Messe, und er hat angefragt, ob ich dafür ein Orientierungssystem entwickeln könnte. Er hat da ganz ausdrücklich gesagt, es sollte mal was Anderes sein, etwas Künstlerisches, etwas, das eben nicht so aussieht wie diese Orientierungssysteme, die es überall gibt. Die sind ja oft sehr genormt. Das Interessante war, dass, als es konkret wurde, die Bank-Leute mir nicht sagen konnten, was sich wo in diesem Gebäude befinden sollte. Das war alles im Fluss, und sie haben auch gesagt, die Raumbelegung ändert sich alle drei Monate, da zieht mal die eine Abteilung dahin und dann machen wir dort was Neues auf und die anderen werden outgesourct. Das ist natürlich für ein Orientierungssystem eine schwierige Voraussetzung (lacht). Dass man nicht weiß, wo sich was befindet, und deswegen habe ich da eine Geschichte produziert, die vollkommen offen ist. Ich hatte auf einer Messe ein, zwei Jahre vorher ein Display gesehen, das von der Firma AEG produziert wird. Das ist ein Pixeldisplay mit einer relativ rustikalen Pixelmatrix, hat aber den Vorteil, dass es unglaublich robust und sehr lichtstark ist. Man kann es über einen farbigen Karton mit egal welcher Farbe hinterlegen.
Ich habe dann auf der Basis von diesem Display das Orientierungssystem gestaltet. Es befinden sich in dem Gebäude circa 65 von diesen Displays. Sie sind alle über ein Netzwerk, das extra eingerichtet wurde, mit einem zentralen Rechner verbunden. Die Darstellung auf dem Display läuft zweigleisig, zunächst sieht man ein Album mit Porträts der Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten. Die Angestellten der Bank haben alle einen Mitarbeiterausweis. Dafür müssen sie ein Passbild abliefern und dieses Passbild wird digitalisiert, bzw. gleich digital aufgenommen. Ich habe mir von zahlreichen Mitarbeitern eine Einverständniserklärung eingeholt, und wir haben auf der Basis dieser Passbilder Pixelporträts angefertigt. Diese Porträts laufen als Slideshow auf den Displays im Gebäude. Alle Displays sind mit einem Bewegungsmelder versehen, und sobald man in die Nähe kommt, springt das Display von diesem Porträtmodus um auf einen Orientierungsmodus, und man kann dann über Typografie und Pfeile sehen, wie man sich im Gebäude bewegen kann.
Das Ganze ist deutsch/englisch, und ich habe extra für die Monitore eine Schrift entwickelt, die wir implementiert haben. Weiterhin gibt es auch eine von mir gestaltete Benutzeroberfläche für einen PC, über die man relativ einfach die Informationen auf den Displays austauschen kann.
Das ist auch ganz hübsch, dass man außer diesen ganz sachlichen Informationen auch verschiedene emotionale Dinge einbringen kann oder auch Spinnereien, so dass die Mitarbeiter sich manchmal an Weihnachten über die Displays Alles Gute wünschen und auf dieser Pixeloberfläche so kleine Schneeflocken generieren. Man kann da eigentlich spielerisch ziemlich viel machen. Das ganze Projekt habe ich mit einer Firma aus dem Taunus für Anzeigensysteme gebaut, NIS-time, die dann auch den Service machen. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, können sie sofort helfen. Das System läuft tatsächlich jetzt schon seit einer langen Zeit reibungslos, die Banker sind sehr zufrieden damit.
EGC: Und wie wird das dort von den Angestellten, die im Hause arbeiten, aufgenommen?
HB: Das wird sehr gut aufgenommen. Es ist ja so, dass die Abteilung «Kunst« der Deutschen Bank sehr großen Wert darauflegt, nicht nur eine hochkarätige Kunstsammlung anzulegen, sondern gleichzeitig diese Sammlung an die Mitarbeiter so zu kommunizieren, dass sie auch stolz darauf sind, dass die Bank sich in der Richtung engagiert. Das ist natürlich auch vor einem anderen Hintergrund noch ganz wichtig: Die Deutsche Bank ist natürlich auch dafür berühmt, dass sie sehr stramm kalkuliert und dass auch manchmal Mitarbeiter gehen müssen, und das muss natürlich alles im richtigen Verhältnis stehen. Die Mitarbeiter denken natürlich aus einem Reflex zunächst auch immer, dass das ihr Geld ist, was da für Kunst ausgegeben wird. Das ist ja in einem gewissen Sinne auch so, weil sie es durch ihre Arbeit mit erwirtschaften. Die Kunstabteilung macht da regelmäßig Mitarbeiterführungen und Veranstaltungen. Ich bin jetzt auch nächsten Monat wieder dort und halte einen Vortrag. Das ist etwas, was zum Unternehmensgeist mit dazu gehört, und die Mitarbeiter sind sehr stolz darauf, dass ihre Bank nicht nur aufs Geld guckt, sondern sich auch für Kultur engagiert.
EGC: Heiner, jetzt kommen wir zu einem Projekt, einem sehr interessanten, Schleifen, 1987 bis 2002 entstanden, eine aufblasbare begehbare Lounge mit Soundsystem. – Das ist als eine Produktion des Balletts Frankfurt am Main unter William Forsythe aufgeführt worden. Ist das richtig so?
HB: Genau.
EGC: Wann und wie hast Du William Forsythe kennengelernt? Und wie kam es zu diesem Projekt?
HB: Bill Forsythe habe ich Ende der 90er Jahre kennengelernt. Ich war vorher schon lange Zeit ein Fan von ihm, habe mir regelmäßig die Ballettaufführungen in Frankfurt angeguckt, und dann tauchte er plötzlich bei einem Hochschulrundgang an der Hochschule für Gestaltung in meinem Bereich auf. Das Interessante war, dass er sich anders verhalten hat, als normale Besucher, die einfach durchgehen und dann schnell wieder verschwinden. Das Phänomen bei ihm war, er wollte einfach nicht mehr nach Hause gehen. Die Ausstellung war schon längst geschlossen und nach zwei, drei Stunden saß er immer noch da und hat sich jede einzelne Arbeit minuziös angeguckt und mit den Studenten kommuniziert. Ich habe dann extra für ihn aufgelassen, und so bin ich mit ihm in Kontakt gekommen, und wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Wie Amerikaner so sind, hat er dann gesagt, wir machen mal was zusammen ... Ungewöhnlicherweise hat er sich dann tatsächlich bei mir gemeldet, als er kurze Zeit später Intendant vom »Theater am Turm« geworden war. Ich habe für ihn über drei Jahre lang am Theater mit Leuten von der Hochschule ein Clubprojekt gemacht, den Schmalclub und habe eigentlich in dieser Zeit auch andere Projekte mit ins Leben gerufen, über die wir jetzt nicht ausführlich geredet haben, weil die aus restauratorischer Sicht nicht so interessant sind. Ich beschäftige mich eben neben meinen künstlerischen Arbeiten, die im Grunde genommen oft zu Produkten führen, auch sehr stark mit sozialen, sozial relevanten Projekten, mit Clubprojekten und Dingen, die vergänglich sind, von denen dann irgendwann auch nur eine Dokumentation und eine Legende übrigbleibt. In einem Gespräch mit Forsythe habe ich ihm von einer Idee erzählt, die mir schon lange vorschwebte, nämlich einen unendlichen Raum zu bauen, in Form einer liegenden, begehbaren Acht. Ich weiß noch genau, das war bei einem Abendessen, bei dem ich ihm das auf einen Bierdeckel gezeichnet hatte, und er war da relativ unkompliziert und hat dann gesagt: »Okay, das machen wir!«
Dann bin ich die Sache angegangen mit seinen Leuten, und das Gute ist natürlich, dass man in diesem ganzen Theaterbereich mit sehr, sehr guten Technikern zusammenarbeiten kann. Da gab es einen Techniker, der Hinrich Drews, der für ihn immer Bauten gemacht hat, dem habe ich geschildert, was ich machen wollte. Mir war noch nicht so ganz klar, wie ich die Konstruktion bewerkstelligen wollte. Er hatte kurz davor den Günther Ganzevoort kennengelernt. Ganzevoort ist ein Produzent von sogenannten Inflatables, er macht aufblasbare Kinoleinwände und solche Dinge, ein sehr experimentierfreudiger Mensch. Er hat seinen Produktionsmittelpunkt in der Nähe von Gießen in Bad Endbach, was natürlich vom Namen her auch sehr gut gepasst hat zu der ganzen Geschichte. Hinrich hat mich dann mit dem Günther Ganzevoort bekannt gemacht, und wir haben relativ unkompliziert das Ding produziert. Ich habe am Computer eine 3D-Zeichnung gemacht, dann aus Stoff und Watte ein kleines Modell gebaut und Günther hat ausgeknobelt, wie man die Schleusen macht, wo man die Luft einspeist und so weiter, und dann wurde aus einer roten Lastwagenplane dieses Monstrum gebaut. Es hat eine Länge von 22 Metern.
EGC: Ist ja gewaltig!
HB: Ja, ist richtig groß. Und das Tolle ist, im nicht aufgeblasenen Zustand passt es auf eine Euro-Palette.
EGC: Nur so groß ist das dann?
HB: Ja. Also wenn wir das irgendwo aufführen, dann kommt Günther mit einem ganz kleinen Transporter angefahren und bläst das Ding zu diesen Riesendimensionen auf.
EGC: Wie lange dauert es, bis es seine Gestalt annimmt?
HB: Das dauert ungefähr zwei Stunden, dann ist es prall, dann wird immer wieder die Luft nach gepumpt.
EGC: Das geht über einen Mechanismus, oder?
HB: Ja, über eine Pumpe. Wir haben die Schleife jetzt mittlerweile vier Mal aufgebaut in Innenräumen und neulich mal in Wien im Museumsquartier auf einer Außenfläche. Den Aufbau der Arbeit betreut immer der Hinrich Drews vom Ballett Frankfurt. Es wird zunächst unten drunter eine Art Teppichboden ausgelegt, so dass sich die ganze Geschichte nicht aufreibt. Die Technik mit den Luftpumpen, die bauen wir dann innen rein, in eins von diesen Augen der Acht, und dann, da komm ich gleich noch dazu, gibt es eben noch eine sehr massive Soundanlage, die haben wir jetzt im Fall der Außenpräsentation auch innen platziert, die kann aber auch außen stehen. Diese ganze Logistik betreut Hinrich Drews, da habe ich nichts damit zu tun, es ist bei ihm in sehr, sehr guten Händen.
EGC: Also, habe ich das richtig verstanden: Der Sound dringt dann von außen durch das Gewebe?
HB: Also: Die ganze Arbeit ist dreiteilig. Sie besteht zum einen aus dieser großen Schleife und zum anderen gibt es einen Soundtrack, der anderthalb Stunden dauert, den ich zusammen mit dem Musiker Peter Kremeier am Computer in Cubase gebaut habe, und dieser Soundtrack besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist gebaut aus Anfangssekunden von Popmusikstücken zwischen 1960 und 2000. Das sind alles relativ populäre Stücke, die mehr oder weniger fast jeder schon mal gehört hat. Der Witz ist, dass wir diese Anfangssekunden nur so lange spielen bis man spürt, dass man das Stück kennt, aber man erkennt es nicht. Aus diesen Schnipseln haben wir ein sehr massives Werk gebaut, es dauert eine Stunde. Das hört sich jetzt sehr konzeptuell an, aber man nimmt es sehr körperlich wahr, es ist ein bisschen fast so etwas wie ein Disco-Inferno. Es hat eine sehr, sehr große Präsenz und bringt auch die Leute regelmäßig auch dazu, in dieser Schleife zu tanzen, weil sie irgendwie gar nicht anders können. Dann gibt es ein zweites Musikstück, Schleife B, das besteht aus den Kratzgeräuschen, die entstehen, wenn eine Vinylschallplatte zu Ende gelaufen ist, und die Nadel in der Auffangrille hängen bleibt. Wir haben Kratzgeräusche aufgenommen von Clubplatten zwischen Ende der 80er Jahre bis Ende der 90er Jahre und haben daraus auch einen sehr massiven Track gebaut. Diese beiden Musikstücke laufen in einer sehr präsenten Lautstärke im ständigen Wechsel. Durch eine Gesamtlänge von anderthalb Stunden, hatten wir das Problem, dass wir das Ganze nicht mehr von einer CD spielen konnten. Bei der ersten Präsentation haben wir das Signal noch über einen Rechner eingespielt, aber das ist natürlich immer irrsinnig aufwändig. Zum Glück ist uns dann die MP3 Technik entgegengekommen und in der aktuellen Version, spielen wir ein 320er MP3 von einer DVD über einen DVD Player.
EGC: Gibt es von diesen zwei Soundtracks denn auch eine CD, oder ist das nur Kunstwerk?
HB: Also, im Moment ist es so, dass man diesen Soundtrack nur hören kann, wenn man an der Installation teilnimmt. Wir hatten überlegt, dass wir es publizieren – das Problem ist natürlich, dass wir dann in Bedrängnis kommen, weil wir diese ganzen Samples klären müssten.
EGC: Um Gottes Willen, ja.
HB: Das ist zwar machbar, aber man müsste dann einen Mitarbeiter für drei Monate freistellen, der bei jedem einzelnen Schnipsel den Musikverlag anfragt, bei dem es erschienen ist, eventuell sogar noch mit den Künstlern Kontakt aufnimmt, und deswegen haben wir das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt.
EGC: Gibt es Probleme, wenn ihr das abspielt, also in der Installation?
HB: Zumindest haben wir es als Problem definiert. Wir spielen das einfach und haben das sogar als eigenes Musikstück bei der GEMA angemeldet. Insofern kriegen wir sogar Tantiemen, wenn es läuft (schmunzelt).
EGC: Heiner, ich habe Dich mit Musik kennengelernt, Sound und Musik spielen für Dich eine ganz große Rolle?
HB: Ja. Die Kunstgeschichtler haben immer so eine Vorstellung von Künstlern, als würden sich die Künstler nur in einem Kosmos bewegen, der wiederum aus anderen Kunstwerken besteht. Als würden sie eben nur darauf reagieren. Das liest sich auch in kunsthistorischen Abhandlungen immer irgendwie ganz flüssig, wie so die eine Sache und Richtung und Bewegung aus einer anderen entstanden ist. Das hatte an dem Punkt auch so eine Intensität, die mich durchaus zu dem Gedanken verleitet hat, mehr in dieser Richtung zu produzieren. Das ist im Prinzip eigentlich nur eine Zeitfrage, weswegen das bisher nicht geklappt hat, da gibt es durchaus Ideen. Aber ich habe einfach zu viel zu tun, als dass ich jetzt diese Baustelle auch noch aufmachen möchte.
EGC: Aber Du tummelst Dich ja auch hier in Frankfurt und in Offenbach in der Musikszene herum?
HB: Ja, nicht nur hier regional, sondern ich kenne mich schon auch darüber hinaus ganz gut aus. Ich habe ja jetzt grade ein großes Projekt laufen in Karlsruhe im ZKM.
Da gibt es die Ausstellung »Vertrautes Terrain. Aktuelle Kunst in und über Deutschland«, und da haben mich die beiden Hauptkuratoren mit ins Boot geholt als Kurator für kulturelle Produktionen außerhalb des klassischen White Cubes. Und da war ich eben auch Kurator für Musik und habe dort in der Ausstellung Computer-Jukeboxes aufgebaut, an denen man von 20 von mir ausgewählten deutschen Musikern Tracks hören kann.
Das war jetzt eine zweite Gelegenheit, bei der diese Vorliebe für Musik dann tatsächliche wieder in diesen Rahmen der Bildenden Kunst Eingang gefunden hat.
EGC: Das ist wirklich ein ganz wichtiger Teil für Dich.
HB: Ja, ja, auf jeden Fall. Wieder zur Schleifen-Installation: Da gibt es noch einen dritten Teil, und zwar ist das ein Buch. Das Buch heißt, wenn man es von der einen Seite anguckt »A« und von der anderen Seite »B«. Es besteht aus ersten und letzten Sätzen literarischer Werke mittlerer Qualität und ist praktisch der Katalog zu dieser Schleifen-Installation. Jeder, der die Schleife betritt, bekommt das in die Hand gedrückt und kann es dann mit nach Hause nehmen. Schleifen ist ein Patchwork von drei unterschiedlichen Entwürfen, die alle etwas zu tun haben mit Zeit und Endlichkeit, die da auf so eine ganz seltsame Art und Weise ineinandergreifen.
EGC: Und das Buch hat, gleichwohl wie die Musik, für Dich ja auch eine sehr große Bedeutung?
HB: Ja.
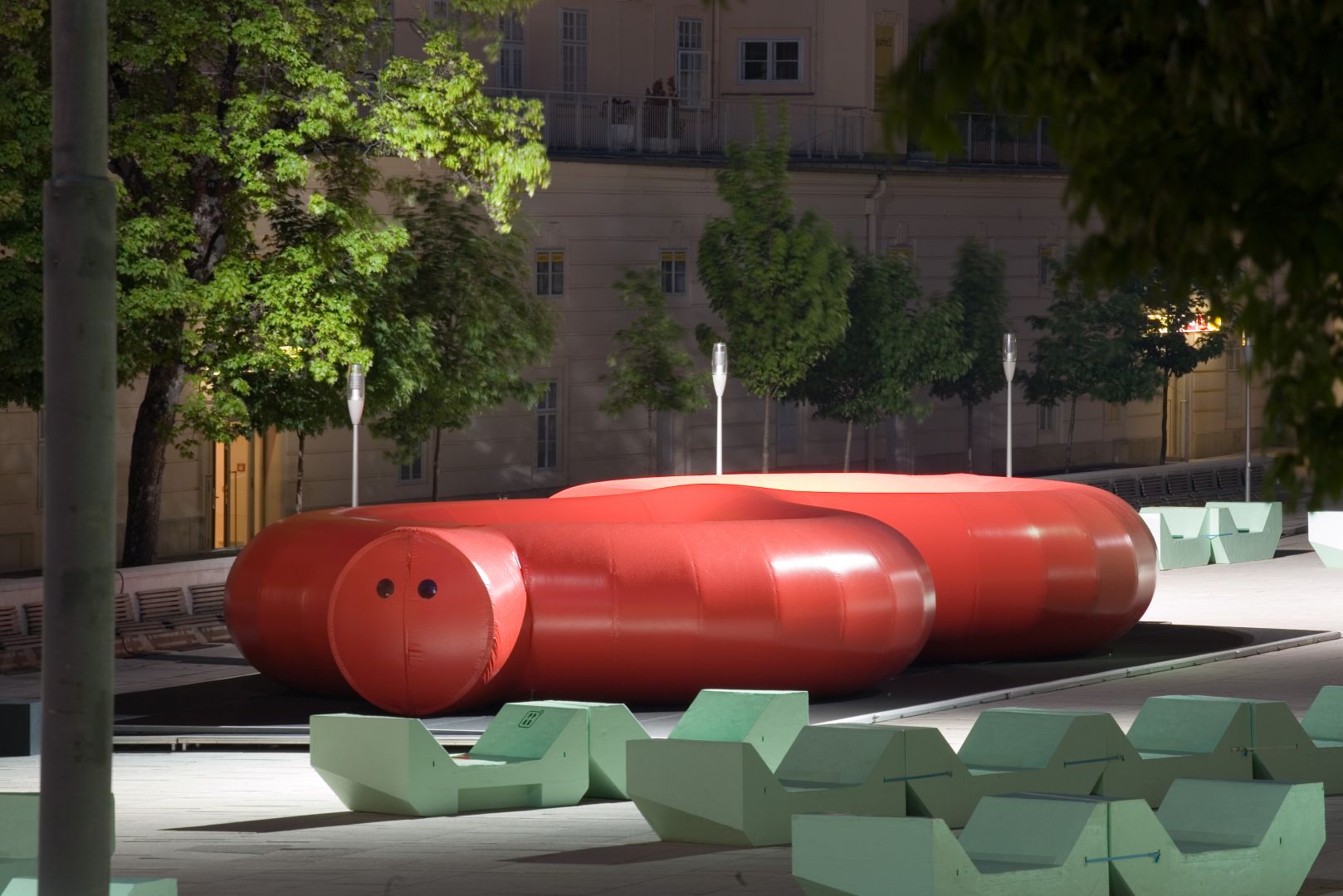





EGC: Du hast schon sehr viele Entwürfe gemacht, ich denke da zum Beispiel nur an den spektakulären Entwurf der roten Bücher für den Suhrkamp-Verlag. Auch den Reprint 1996 für Band 1 »Archiv für Techniken und Arbeitsmaterialien zeitgenössischer Künstler« hast Du gestaltet.
HB: Ich bekomme sehr oft zu hören, dass meine künstlerischen Arbeiten zu grafisch sind. Für viele Leute ist das so was wie eine Diskreditierung, für mich irgendwie gar nicht. Ich habe ein sehr großes Interesse an Typografie und Grafikdesign und sehe da sehr fließende Grenzen. Also für mich ist auch jemand wie Adrian Frutiger, ein Schriftgestalter, ein großer Künstler, aber der wird normalerweise eben in einem anderen Segment abgefeiert, das gilt für viele eigentlich mehr als so eine kunstgewerbliche Geschichte. Ich habe da nie ein Problem gehabt zu sagen, okay, ich mach für den Suhrkamp-Verlag eine Buchreihe und arbeite da als Grafikdesigner. Wenn man sieht, was Willy Fleckhaus gemacht hat für diesen Verlag, ist es natürlich eine Riesenehre. Da wird bei mir auch noch einiges kommen in der Richtung, denke ich.
EGC: Heiner, zu Assistenten hätte ich noch eine Frage: Arbeitest Du mit Assistenten zusammen? Wenn ja, was wird von ihnen ausgeführt?
HB: Also, ich arbeite eigentlich schon sehr, sehr lange mit Assistenten zusammen. Ich habe ja vorhin beschrieben, dass ich in den 80er Jahren nach meinem Studium als Fotograf gearbeitet habe für große Magazine. Ich habe dadurch relativ viel Geld verdient und habe das Geld dann genutzt, um meine Arbeiten zu produzieren. Ich habe auch ziemlich schnell angefangen, Leute anzustellen, und das hat sich im Lauf der Zeit so ein bisschen gewandelt. In den 80er Jahren hatte ich Assistenten, die mir geholfen haben, Dinge technisch zu realisieren. Das heißt, die haben zum Beispiel Holzarbeiten gemacht. Mittlerweile, und das eben schon seit zehn Jahren, arbeiten die Assistenten vorwiegend am Computer, und die technischen Arbeiten lasse ich eigentlich weitgehend von professionellen Firmen wie Nordlicht ausführen. Mit den Computerarbeiten war es in den 90er Jahren so, dass ich in meinem Atelier sehr viele große Rechner stehen hatte und immer drei, vier Leute anwesend waren. Dadurch, dass die Computer günstig und klein geworden sind, haben eigentlich alle Assistenten, die für mich arbeiten einen eigenen Rechner, und wir shuttlen die Daten übers Internet hin und her. Es gibt zum Beispiel, eine Zeichnerin in Berlin, die für mich regelmäßig arbeitet, ohne dass sie bei mir im Atelier sitzen muss. Also, das hat sich schon sehr stark gewandelt in den letzten Jahren.
EGC: Also eine sehr moderne Arbeitsweise?
HB: Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel für das Wollheim Memorial einen Projektleiter, der auf verschiedenen Ebenen die Technik koordiniert. Hier geht es zum einen um die Bildtafeln im Park, über die wir gesprochen haben, und dann geht es aber auch um einen Infopavillon, der umgebaut werden musste, und um ein Infoportal. Der Projektleiter ist Bernd Euler aus Berlin, ein Schlossermeister, der bei uns an der Hochschule studiert hat, er war der technische Leiter vom Schmalclub gewesen, und hat sich jetzt selbstständig gemacht, um für Künstler Projekte zu koordinieren. Das ist eine sehr, sehr große Hilfe, weil er jemand ist, der auf ganz vielen verschiedenen Ebenen recherchiert, die richtigen Leute sucht und eben die Ausführung auch koordiniert. Bernd Euler ist jemand, auf den ich mich sehr gut verlassen kann, und das hält einem natürlich ganz gut den Rücken frei.
EGC: Jetzt habe ich noch ein paar Fragen zur Lagerung: Wie lagerst Du die Arbeiten auf Papier zum Beispiel?
HB: Also, ich habe selber ein Lager hier in der Nähe von meinem Haus, das ist so ein Souterrain in einem 60er-Jahre-Gebäude. Ein Raum, der sehr trocken ist, weil da die Heizungsrohre von dem ganzen Gebäude durchgehen. Da ist selber keine Heizung drin, aber es ist eigentlich nie feucht. Dort habe ich eine Hängeregistratur und einen Papierschrank, in denen die Sachen drin liegen. Da gibt es eine ganze Reihe von DinA4-Skizzen, eigentlich hunderte, die ich aber nie als autonome Zeichnungen wahrgenommen habe. Die habe ich in dem Schrank mit den Hängeordnern drin, und dann gibt es auf der anderen Seite bei meiner Galerie, bei Bärbel Grässlin, Zeichnungen und Papier-Arbeiten. Ich glaube aber, dass da gar nicht so viele Arbeiten mehr sind, weil wir die ja alle mehr oder weniger verkauft haben. Die Passepartout-Serie hat sich sehr gut verkauft, dann hat die Dresdner Bank, die Deutsche Bank, ein relativ großes Konvolut an Papierarbeiten, der Sammler Michael Loulakis hat eine ganze Reihe von Papierarbeiten, und die sind alle ganz fachgemäß unter Passepartouts. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren wenig Papierarbeiten produziert. Hat mich nicht wirklich interessiert, sondern ich bin immer gleich in die Vollen gegangen. Das, was ich früher an Skizzen gemacht habe, mach ich mittlerweile alles am Computer, da gibt es eine Menge von digitalen Zeichnungen und Konzepten. Die habe ich eigentlich noch nie ausgedruckt und in irgendwas Handelbares verwandelt.
EGC: Und Du hast mit Sicherheit immer mit sehr hochwertigem Papier gearbeitet?
HB: Hm.
EGC: Nein?
HB: Kann man nicht sagen. Ich habe eine sehr große Vorliebe für Büro- oder Alltagspapiere. Als ich in Rom war, so um 1990, habe ich sehr intensiv gezeichnet und habe dann mir sehr gerne aus italienischen Schreibwarengeschäften Papiere besorgt, die zum Beispiel einen seltsamen Linienaufdruck hatten. Auch in Spanien habe ich immer gerne Papier eingekauft, es waren dann oft Papiere aus irgendwelchen Heften oder aus Blöcken, die eigentlich für Kanzleien gedacht waren. Ich mochte das immer gern, wenn ein Papier schon so was wie eine Bestimmung hatte oder eine Geschichte, doch das waren oft Papiere, die nicht besonders hochwertig waren, das mochte ich immer lieber.
EGC: Das war eine rein formalästhetische Entscheidung gewesen?
HB: Ja, aber das ist ja in der Kunst durchaus sehr verbreitet, Du musst ja nur an Beuys oder Kippenberger denken. Als es dann bei mir mehr in Richtung Computer ging, dann hörte das auf, dass ich ständig gezeichnet habe, und ich hatte dann noch ein Riesenkonvolut an solchen Papieren übrig, die ich dann der Zeichnerin Bea Emsbach vermacht habe, die jetzt damit weiterarbeitet. – Bea ist übrigens auch meine Hauptzeichnerin bei den Figuren für die Glasfenster-Projekte.
EGC: Es gibt ja viele Zeichnungen von der Bea Emsbach, die auf gefärbten Papieren gemacht sind.
HB: Ja, die hat sie teilweise von mir (lacht).
EGC: Ah ja? Ich wollte noch mal sagen, ich find das absolut okay. Das Problem, wie sich das Papier nachher verhält und wie es gepflegt wird, das liegt auf Seiten der Restauratoren.
HB: Ja, genau!
EGC: Und ich find die Entscheidung des Künstlers, mit welchem Material er arbeitet, die hat absoluten Vorrang.
HB: Ja. Und ich habe auch ab und zu mal in der ehemaligen DDR eingekauft, und die hatten ganz merkwürdige Drucksachen, die wie aus einer anderen Welt kamen. Da habe ich zum Beispiel mal Wasserfarben gekauft und verarbeitet. Und so ein Blatt habe ich dann aufgehängt: Es war sehr erstaunlich, wie schnell sich das farblich verändert hat und die Farben ausgeblichen sind. Trotzdem hatte das einen spezifischen Charakter, der eben anders ist als eine Windsor & Newton-Aquarellfarbe, und ich habe die DDR-Farbe dann trotzdem gern verwendet.
EGC: Ja, es kommt natürlich immer auf die atmosphärischen Bedingungen an, wie die Dinge und in welchem Ambiente sie gelagert oder gezeigt werden. – Wie lagerst Du zum Beispiel Filmnegative oder die Diapositive?
HB: Die Negative befinden sich in diesen klassischen Din A4-Einschubhüllen. Ich bin jetzt grade wieder mit diesem Negativarchiv umgezogen und habe ein bisschen Angst davor, mir die Sachen anzugucken, weil ich damals damit nicht besonders pfleglich umgegangen bin. Damals kamen irgendwann diese Klarsichthüllen auf, die dann für Fotografen praktisch waren, weil man dann gleich den ganzen Negativbogen für einen Kontaktpapierabzug auf ein Papier legen konnte, Glasplatte darauf, durchbelichten, während bei diesen klassischen Hüllen…
EGC: Den Pergaminhüllen.
HB: Bei den Pergaminhüllen musste man die Streifen alle rausziehen. Das war immer irgendwie lästig, bis ich dann auf diese durchsichtigen Hüllen umgestiegen bin. Ich habe damals schon gemerkt, dass in diesen modernen Hüllen die Negative schnell zu schwitzen anfangen und habe dann eben wieder lieber die Pergaminhüllen verwendet.
EGC: Ja, es gibt mittlerweile sehr gute Aufbewahrungshüllen von Monochrom, stabile Materialien.
HB: Ich habe aus meiner Zeit als Fotograf ein Riesennegativarchiv. Damit müsste ich mich auch viel mehr beschäftigen, um das alles safe zu machen. Die Zeit habe ich irgendwie nicht. Da mache ich lieber neue Sachen!
EGC: Hast Du schon mal überlegt, Dein Negativarchivmaterial zu digitalisieren?
HB: Ich wüsste nicht warum. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Art, wie ich zum Beispiel die Serie Menschen geprintet habe, heute gar nicht mehr realisierbar wäre: Das Papier und die Entwickler gibt es gar nicht mehr. Gut, man könnte das vielleicht chemisch wieder so zusammenmischen, aber das wäre doch auch irgendwie seltsam. Ich habe mir schon öfter überlegt, weil es von dieser »Menschen«-Serie nur eine ganz begrenzte Anzahl von Vintage-Prints gibt, dass, wenn es eine Nachfrage gäbe, man die ganze Geschichte digitalisieren, im Rechner nachbearbeiten und dann mit einem guten Drucker ausprinten könnte. Das wäre dann aber natürlich etwas Anderes.
EGC: Ja. – Welche Hardware und Software verwendest Du, wenn Du für andere digitale Sicherungskopien erstellst? Speicherst Du das ab? Hast Du alle Deine Arbeiten abgespeichert, wenn ja, wie, auf der Festplatte von dem Computer oder benutzt Du auch externe Festplatten?
HB: Da gibt es unterschiedliche Generationen von Sicherungssystemen, mit denen ich bisher gearbeitet habe. Als ich anfing, an Sicherungskopien zu denken, das war gerade die Zeit, in der die Firma Syquest die Nase vorne hatte, da gab es dann die so genannten Jaz-Laufwerke. Davon hatte ich allein drei Stück bei mir im Atelier und damit haben wir immer täglich Sicherungskopien gemacht. Die waren nicht immer unbedingt zuverlässig, und dann kam zum Glück relativ schnell die Zeit, wo man auf CDs Sicherungskopien machen konnte, dann später auf DVDs. Jetzt habe ich eine Menge riesiger, externer Festplatten, auf denen ich die Daten speichere, aber mir sind auch schon ganze Festplatten abgerauscht. So ist das Ziel, jede Festplatte doppelt zu haben und gleichzeitig die Daten noch mal auf DVDs zu sichern. Das ist das, worauf ich jetzt die nächsten Monate darauf hinarbeite. Dann muss ich auch die ganzen Sicherungs-CDs aus den letzten zehn Jahren noch mal durchgucken, gucken, ob das Material noch in Ordnung ist. Es gibt da leider ein relativ großes Problem. Dadurch, dass ich viele Zeichnungen mit einem Programm gemacht habe, das es inzwischen nicht mehr gibt. Mein Lieblingsprogramm Freehand ist von Adobe aufgekauft worden, um es dann ganz bewusst still zu legen und um das Programm Illustrator weiter nach vorne zu bringen. Da gibt es schon massive Unterschiede zwischen den beiden Programmen, weswegen ich mich da noch ein bisschen sperre, umzusteigen, aber ich muss dann irgendwann mal meine ganzen Freehand-Daten umformatieren auf Illustrator oder In Design, damit ich noch in der Zukunft mit denen arbeiten kann.
EGC: Aber das ist ja eine heillose Arbeit.
HB: Na gut, wenn man sich konzentriert und nur die Enddaten nimmt und nicht die ganzen Vorstufen, dann geht es. Auf jeden Fall ist es, denke ich, sinnvoll, dass es Leute gibt, die versuchen nahtlos alle Generationen von Rechnersystemen zu sammeln und dann praktisch auch alle Schritte, die eine Software macht, die von Künstlern benutzt wird, archivieren, um dann gegebenenfalls in 50 Jahren noch eine Datei von einem Künstler abspielen zu können von 1990. Ich erinnere mich gerade an diese ganzen Festplatten, die man früher hatte, alle mit diesen SCSI-Anschlüssen, es gibt heute keinen aktuellen Rechner mehr, an den man diese Festplatte anschließen kann. Also, das ist wichtig, dass es da Leute gibt, die in diesem Bereich aufpassen, dass uns da nichts Wesentliches verloren geht.
EGC: Das Problem habe ich zurzeit mit einem fantastischen Laserdrucker von Apple, den ich jetzt auf dem neuen Rechner nicht mehr anschließen kann. Geht nur noch auf dem G3, den ich noch habe. Aber auf dem G3 kann ich wiederum nicht Dinge, die ich auf dem PowerBook G4 generiert habe, abspielen.
HB: Interessant ist ja auch, dass Künstler in den letzten zehn Jahren auch Arbeiten als Tintenstrahldruck ausgegeben haben. Vor zehn Jahren war der Standard vielleicht bei 300 DPI und mittlerweile bei über 1200 DPI. Wenn man die Arbeit heute eben noch mal nachdruckt, hat man eventuell das Problem, dass der Druck eventuell zu gut ist, um die Arbeit, wie sie damals gemeint war, rüberzubringen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass ein Künstler sagt, ich hätte es mir gewünscht zu der Zeit, die Arbeit in der Brillanz auszudrucken. Man kommt da leicht ins Trudeln, weil ein Kunstwerk auch immer so ein bisschen ein Kind seiner Zeit ist und dann auch in Relation mit den Techniken der Zeit steht. Im Computer und gerade im Printbereich ist die Entwicklung so rasant, dass sich da einfach unscharfe Bereiche ergeben, wo man sich erstmal neu orientieren muss.
EGC: Ich sehe, Du hast hier einen Epson Drucker stehen, ein ziemlich großes Gerät.
HB: Ja.
EGC: Was machst Du mit diesem Gerät?
HB: Den Epson Drucker benutze ich nur intern, um Sachen auszuprinten, die ich als Zwischenstufe beurteilen will, die aber dann später in einer anderen Technik ausgeführt werden. Ich benutze ihn sehr oft auch für Präsentationen, wenn ich zu einem Wettbewerb eingeladen bin. Dann mache ich meistens eine Reihe von Ausdrucken in DinA2. Für mich drucke ich eigentlich diese ganzen Entwürfe nicht mehr aus. Ich hatte eine Zeit lang Dossiers angelegt und habe mir alles, was ich nach außen gegeben habe, als Präsentation auch in DinA2 ausgedruckt. Mittlerweile speichere ich diese Sachen eher als PDF, weil, wenn man mit anderen Leuten kommuniziert, das doch der wesentlich bequemere Weg ist, ein PDF irgendwohin zu schicken als eine Riesenmappe. Ich plane aber im Moment eine ganze Reihe von Grafikmappen auf der Basis der Glasfenster-Zeichnungen. Ferner wird es eine Weiterführung der Alarm-Serie geben.
EGC: Ich sehe neben mehreren PowerBooks auch hier einen G4 Rechner stehen mit einem ganz speziellen reflexionsschutzverkleideten Monitor, der sehr wahrscheinlich gut kalibriert ist.
HB: In der meisten Zeit arbeite ich mit einem 17-Zoll-PowerBook, das ist ein Gerät, mit dem ich eigentlich alles machen kann, was ich mir vorstelle, das ist wie für mich gemacht. Ich bin sehr begeistert davon und auch die Monitorgröße ist wunderbar, weil man bei grafischen Anwendungen Platz hat, die ganzen Paletten unterzubringen. Normalerweise arbeite ich auch nicht mit einem externen Monitor oder mit einer Maus, das ist jetzt eigentlich sehr gut, so wie es ist, da gibt es eben dann noch Festplatten dazu. Neben diesem Hauptlaptop habe ich noch ein zweites Laptop, mit dem ich aber mehr Filme aufnehme und schneide und die ganzen Audiogeschichten mache, und dann gibt es noch einen großen Rechner mit einem kalibrierten Bildschirm, der vorwiegend von einem Assistenten bedient wird, da machen wir Photoshop-Anwendungen darauf.
EGC: Wie jetzt zum Beispiel das Wollheim-Projekt?
HB: Wollheim Memorial. Und da sehe ich mir aber auch zum Beispiel eingescannte Dias und solche Sachen darauf an, bevor ich die zum Druck freigebe.
EGC: In welchem Ambiente wie Raumklima oder Temperatur werden die digitalen Sicherungskopien aufbewahrt?
HB: Die sind in meinem Büro.
EGC: Du hast also alles mehr oder weniger hier?
HB: Ja.
EGC: Benutzt Du eigentlich auch so Einrichtungen – es gibt ja Firmen, bei denen man die digitalen Daten ablegen bzw. speichern kann?
HB: Wir haben jetzt für das Wollheim Memorial, weil da ja eine sehr, sehr intensive Recherche im Hintergrund gelaufen ist, auf dem Server von der Uni Frankfurt ein sehr großes Segment eingeräumt bekommen, auf das wir die Daten drauf gespielt haben. Das gilt auch für die 25 Interviews, die ich habe machen lassen. Das ist natürlich ein unendlich großer Schatz. Diese Interviews haben wir sowohl auf internen als auch auf externen Festplatten, sowie auf DVD gesichert und noch mal auf diesem Uni-Server. Dadurch, dass es bei diesem Projekt eine sehr große öffentliche Verantwortung gibt und die Uni Frankfurt einen Großteil bezahlt hat, war es naheliegend, das so zu machen. Die eigenen Projekte betreffend, habe ich das nicht gemacht, was natürlich dumm ist, wenn die Hauptdaten und die Sicherungskopien in einem Raum nebeneinander stehen. Das müsste man eigentlich anders machen.
EGC: Welchen Stellenwert hat für Dich der Bilderrahmen?
HB: Bilderrahmen gibt es einmal bei den Repro-Bildern, das sind diese schwarzen Leisten, die ich selber drangemacht habe. Das sollte man respektieren, da kann man jetzt nicht irgendwie die Leisten wegreißen und einen Goldrahmen dranmachen. Das ist in dem Fall ein Teil der Arbeit. Und wenn jetzt der Rahmen wegfaulen würde, sollte man den genau so auch wieder reproduzieren. Bei den Papierarbeiten habe ich es persönlich am liebsten, wenn man die Arbeiten mit einer relativ schlichten Holzleiste einrahmt, also so was wie Buche oder Esche oder es geht auch ein Nadelholz. Je nach Arbeit kann man die Sachen unter Passepartout setzen oder man kann sie frei mit einer Abstandsleiste hinters Glas hängen. Was ich nicht mag sind zum Beispiel weiß lackierte oder farbig lackierte Rahmen oder Metallleisten.
EGC: Was das Holz angeht, da bevorzugst Du ein weniger emotionales Holz in der Musterung?
HB: Ja, ja. Auf jeden Fall.
EGC: Jetzt komme ich zu dem Block inhaltlicher Fragen zur Konservierung und Restaurierung, die von Dir zum Teil bereits gestreift wurden. Wir Restauratoren wissen aus eigener Erfahrung, dass gerade die Unklarheiten über Details der künstlerischen Konzeption und Materialverwendung zu großen Problemen und Missverständnissen bei der Betreuung in der Sammlung und bei Ausstellungen führen können. Insofern sind folgende Punkte von großer Wichtigkeit für die Betreuung Deiner Werke: In wieweit akzeptierst Du materialimmanente Alterungsprozesse, zum Beispiel Verblassen, Vergilben und Verspröden von Farben, von Druckfarben, Tinten, Tuschen, Farbstiften und auch von Papieren, Pappen, Kartons, also den Materialien aus denen Deine grafischen und fotografischen Werke inklusive Dias bestehen?
HB: Das nützt natürlich jetzt nicht viel, wenn ich sage, es kommt drauf an … (lacht). Das müsste ich mir im Einzelfall ansehen, also ich versuche jetzt mal so ein paar Pauschalisierungen abzuwägen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich bewusst mit minderwertigen Papieren gearbeitet habe. Natürlich ist dann klar, dass ich auch akzeptieren muss, dass die vergilben oder die Farben dann irgendwann blasser werden. Das gehört dann mit dazu. Lichtgeschützt präsentieren! Oder bei den Radiergummiarbeiten gehört dazu, dass die ausbleichen und verspröden. Was ich zum Beispiel ganz hässlich fände, was ich mir nicht vorstellen möchte, wäre, dass ein Radiergummibild in einem Plexiglaskasten gezeigt wird und man einfach dann an die Arbeit nicht mehr drankommt. Oder bei den Fotoarbeiten, bei den Reprobildern, habe ich so ein ganz mattes Papier verwendet. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man irgendwann eine Glasscheibe oder eine Plexiglasplatte davor macht. Das fände ich ganz hässlich und würde der Arbeit, so wie sie gemeint ist, widersprechen. Ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, als das MMK von meinen Gebläse-Glasarbeiten einige Exemplare gekauft hat, und dass es möglich war, diese Arbeiten praktisch ohne einen zusätzlichen Schutz zu zeigen. Es gibt für diese Arbeiten jeweils ein Metallgestell, in dem die Glasskulptur eingehängt wird. Man könnte natürlich auf die Idee kommen, dieses Gestell noch mal mit Glas zu bestücken, um die Skulptur zu schützen. Da hat das MMK gesagt, nein, wir setzen einfach eine besonders starke Bewachung ein, dass hier nichts passieren kann. Und das finde ich toll, weil das so der Arbeit am meisten entspricht. Es ist aber auch schon mal in einer Ausstellung eine Glas-Arbeit zerstört worden von Kindern, die einfach gegen so ein Gestell gelaufen sind, und dann war sie halt kaputt. Das lag daran, dass sie nicht gut bewacht wurde.
EGC: War das im Museumsbereich geschehen?
HB: Ja.
EGC: Was mir während meiner Zeit am MMK gefiel, war die Einstellung von Jean-Christophe Ammann, dass man den Kunstwerken unmittelbar und ohne Einschränkung oder Schranken begegnen konnte.
HB: Ja.
EGC: Und ich halte es auch für die bessere Politik, verstärkt Aufsichten einzusetzen, als Objekte durch irgendwelche Maßnahmen in ihrer Funktionsweise, die sie haben, einzuschränken. – Jetzt zu Rissbildungen, Materialschwund und Verfärbung von Hölzern?
HB: Ich hatte zum Beispiel bei der Werkgruppe Spiele/Games das Problem, dass da durch unsachgemäße Behandlung in den Bereichen, wo ich den Schultafellack aufgetragen hatte, Kratzer drin waren oder Farbspritzer, die ein Anstreicher draufgemacht hat. Die Arbeiten waren dadurch in ihrer Präsenz sehr stark gestört, und ich habe dann diese Arbeiten gemeinsam mit meiner Frau, die Restauratorin ist, wiederhergestellt. Und das haben wir ganz einfach so gemacht, dass wir die Schrift noch mal mit einer Schablonenfolie überdeckt haben, dann haben wir den Schultafellackhintergrund an den Stellen, wo er beschädigt war, durch Kitten wieder auf dieselbe Ebene gebracht. Dann habe ich die Farbe noch mal genau in dem Farbton angemischt, in dem sie war, und habe das dann komplett überrollt. So ist dann wieder der ursprüngliche Charakter entstanden, wie die Arbeit war und gemeint war. Das kann man im Prinzip so machen, aber man kann natürlich auch dabei Fehler machen und insofern, weiß ich nicht, ob ich das jedem anvertrauen würde. In dem Fall kann ich’s jetzt noch selber machen, das muss man immer auch abwägen. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass dann diese schwarze Fläche nicht mehr als geschlossene Fläche wahrnehmbar wäre. Es ist immer eine Frage der Ausdehnung oder der Dimension; wenn es ein kleiner Fehler ist, ist es nicht so schlimm. Man kann das dann ausflecken. Man muss aber abwägen, inwieweit Fehlstellen oder Retuschen diese homogenen Oberflächen stören. Also im Fall von der erwähnten Uhr in Stuttgart, die diesen Fehler hat, muss man auf jeden Fall komplett lackieren, das wäre absurd, das zu retuschieren, die Fläche muss eine Geschlossenheit haben, die nicht unterbrochen wird.
EGC: Wie ist es mit dem Korrodieren von Metallen?
HB: Metall gibt es zum Beispiel bei diesen Speichen von Joan Crawford Striches A Pose, das ist ja Eisenvierkantrohr, das sichtbar sein soll als Eisen, das ist mit einem Klarlack behandelt, damit es nicht oxidiert. Falls es oxidieren sollte, sollte man einfach den Rostflug wegnehmen, und es dann noch mal mit einem Klarlack überziehen.
EGC: Hast Du generell alle blanken Eisenteile, Stahlteile oder sonstige Metallteile in der Vergangenheit mit einem Schutzlack überzogen?
HB: Genau. Habe ich alle klar lackiert.
EGC: Jetzt kommen wir zum Fragenkomplex der Werkgerechtigkeit des Originals. Welchen Standpunkt hast Du zur Frage, ab wann die Originalität bzw. Authentizität und Werkgerechtigkeit des Kunstwerkes gefährdet und in Frage gestellt ist? Wie sollte man Deiner Meinung nach bei Abnutzung oder Verlust einzelner Teile in Deinen Werken vorgehen?
HB: Wenn man jetzt zum Beispiel die Glasskulpturen nimmt: Bei der Gebläse-Serie, kann ich mir vorstellen, dass ich ein Werk, das kaputtgegangen ist, möglichst mit Hilfe desselben Glasbläsers noch mal anfertigen lasse, wobei es da einen gewissen handwerklichen Spielraum gibt, so dass das mit Sicherheit nicht dasselbe wäre. Wenn das ein anderer Glasbläser wäre als der Herr Kergl, dann wird das auch eine andere Handschrift haben, das ist ganz klar. Man müsste dann in dem Fall bei der Benennung dazuschreiben, das ist eine Arbeit von dann und dann, die dann und dann zerstört und reproduziert wurde. Da ich beim Herstellen jeder Glasarbeit daneben saß, kann ich mir vorstellen, das so zu machen, aber wenn das in 100 Jahren jemand reproduziert, ist das mit Sicherheit etwas Anderes. Das kann dann eigentlich nur noch ein Abklatsch von dem sein. Da löst sich dann der Begriff vom Original auf jeden Fall auf. Das muss man dann abwägen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
EGC: Du wirst keinen Einfluss mehr darauf haben, aber Du könntest doch durch bestimmte Aussagen, die wir jetzt versuchen, hier von Dir zu bekommen, das dann auch eingrenzen.
HB: Ich habe mir gerade ein sehr schönes Buch gekauft über antikes Glas, in dem man Gläser sehen kann, die schon 2000 Jahre oder älter sind. Da gibt es ein paar wenige Gegenstände, die vollkommen erhalten sind, und es gibt andere, die im Laufe der Zeit kaputtgegangen sind, die wurden dann wieder geklebt. Die erinnern natürlich noch an die ursprüngliche Form, aber es ist nicht mehr dasselbe. Das Glas lebt natürlich schon davon, dass es makellos und ohne Riss ist. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass man so eine kaputte Glasarbeit auch wieder klebt, aber es ist trotzdem weit entfernt von dem, wie es eigentlich gemeint war.
EGC: Das kann man ja an dem Großen Glas von Marcel Duchamp sehen.
HB: Ja, obwohl da natürlich die Risse dazu gehören. Er hat das ja praktisch wieder umgedreht, die ganze Geschichte. Das wäre bei mir aber nicht so (beide lachen). Lass uns noch mal auf diese Spiegelarbeiten kommen, die es von mir gibt. Da kann es natürlich auch passieren, dass so eine Scheibe kaputtgeht. Dadurch, dass das Ganze aber einen durchaus industriellen Charakter hat, kann ich mir sehr leicht vorstellen, dass man das wieder reproduziert. Dass man eine Floatglasscheibe nimmt, in genau derselben Stärke, den Rand gleich behandelt, dass man die Komposition genau abmisst, abnimmt, wieder schabloniert, dann dieselbe Farbe auflackiert und das wieder von hinten verspiegelt. Das wäre für mich dann schon dieselbe Arbeit. Oder würde der Arbeit entsprechen, so wie ich sie gemeint habe. Es wäre mir dann so sogar lieber, als wenn das in tausend Scherben gefallen wäre, und man klebt es dann wieder zusammen.
EGC: Wo gibt es bei konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen für Dich eine Grenze, wo sollte ein Restaurator oder eine Restauratorin die Hände weglassen?
HB: Ich habe jetzt nur ein Beispiel, das in die andere Richtung geht. Wir haben darüber gesprochen, dass ich die Repro-Bilder und die Serie der Porträts selbst entwickelt habe, so gut ich das irgendwie hinbekommen habe, aber trotzdem kann es sein, dass dann im Lauf der Zeit, so ein Bild vielleicht gelbe Flecken bekommt oder unansehnlich wird, Ausblühungen hat, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, wenn das über ein bestimmtes Maß hinausgeht, dass es dann besser wäre, die Arbeit neu zu drucken. Es gibt zu diesen Arbeiten ein Negativ, und ich gehe mal davon aus, dass wenn das soweit wäre, es auch keine Projektionsvergrößerung mehr gibt auf Fotopapier, aber man könnte dann das Negativ einscannen, und auf einem gleichwertigen Papier könnte man die ganze Geschichte ausplotten und wieder aufziehen auf eine Aluminiumplatte und eben wieder den Rahmen drum rummachen, den ich zum Beispiel auch verwendet habe. Das wäre mir lieber in der Vorstellung, als wenn dann irgendwie so ein ganz scheckiges Bild im Museum rumhängt. Also, wenn die Fehler zu rustikal wären, würde ich bei verschiedenen Arbeiten, auch bei diesen Floatglasspiegeln sagen, dann sollte man sie lieber neu aufbauen.
EGC: Und was ist, wenn das einfach zu viele Spuren von Herumdoktorei zeigt? Dann ist das andere doch mit Sicherheit der bessere Weg.
HB: Ja, genau. Um noch mal wieder auf die Spiele/Games-Kästen zu kommen. Wenn da an dieser Oberfläche rumgefriemelt würde und man sähe überall Flecken, dann lieber einfach gleich komplett drüber. Es gibt ja zum Beispiel bei der Restaurierung von alten Gemälden die Philosophie, dass man praktisch nur das stehen lässt, was der Künstler selber gemalt hat und Fehlstellen einfach als Fehlstellen kenntlich macht, indem man einfach mit einer Schraffur arbeitet oder so. Aber ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht bei so einem Games-Kasten vorstellen, dass, wenn irgendwo eine Ecke weggebrochen wäre, dass man das praktisch dann wieder auffüllt und statt diesem Schwarzgrün, was ich verwendet habe, dass man sagt, okay, dann lässt man da das MDF stehen oder so. Das fände ich ganz schlimm.
EGC: Jetzt zu mechanischen und elektronischen Verschleißteilen, zum Beispiel Antriebsmechaniken, Batterien, Elektromotoren, Klingelmechanismus, Kugellager, Lautsprecher und Radioempfänger, Leuchtmittel, Metallseile, Projektion und Lichtinstallation, Räder, Soundsysteme oder Uhrwerke. Wie und was würdest Du empfehlen, und was würdest Du Deiner Meinung nach für richtig finden, wie man mit diesen Stücken umgeht?
HB: Diese Dinge gibt es in den Arbeiten zum einen verdeckt, so dass man sie nicht sieht, also so ein Kugellager wie bei Joan Crawford Striches a Pose sieht man ja nicht, und das kann man jederzeit austauschen. Wenn es um sichtbare Dinge geht, dann kann man davon ausgehen, dass alles was man sieht, von mir auch ganz bewusst ausgewählt wurde, das heißt, das kann man nicht nach Belieben austauschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Zeitzünderbombe einen roten Draht verwendet habe, kann man da keinen grünen Draht dranmachen. Dann müsste man versuchen, einen möglichst ähnlichen Draht zu finden. Über die Batterien haben wir schon gesprochen, da habe ich mir irgendwann abgeschminkt, zu sagen, es müssen jetzt unbedingt diese polnischen Katzenbatterien sein, die kriegt man nicht mehr. Da würde ich empfehlen, man nimmt einfach die Duracell-Batterien, die es zu der Zeit gibt. Oder man nimmt, wenn die Firma Duracell nicht mehr existiert, den Marktführer aus der jeweiligen Zeit. Es kann aber natürlich das Problem auftreten, dass es in 100 Jahren keine Batterien mehr in diesem Zuschnitt gibt. Was macht man dann? Dann sollte man in dem Batteriefach die Batterien belassen, so wie ich sie ausgesucht habe oder wie es der letzten Fassung entspricht. Man muss sich natürlich darum kümmern, dass sie nicht auslaufen, und müsste, was die Energieversorgung betrifft, eine verdeckte Energiezufuhr machen. Das heißt, dass es einfach ein zweites, verdecktes Energiesystem geben könnte, was dann die Energie einspeist. Es gibt da ein sehr großes Problem mit den Klebebändern. Die gehören blöderweise mit dazu. Also, wenn ich da so ein Bündel Papprohre mit einem Faser-verstärkten Klebeband umwickelt habe, dann will ich eigentlich auch das verstärkte Klebeband da draufhaben, und das kann man eigentlich nur im Fall der Fälle durch ein gleichwertiges Klebeband austauschen. Man könnte es nicht durch transparentes Klebeband ersetzen oder durch ein braunes Tape. Das ginge nicht. Also, wenn man es hinkriegt, ein Klebeband zu finden, das genauso aussieht, dann funktioniert das, und ansonsten sollte man die Finger davonlassen.
EGC: Wie verhält sich es zum Beispiel bei den Leuchtmitteln, Projektionen oder Soundsystemen, bei Lautsprecher oder Radioempfänger. Das ist ja auch vom Typ abhängig, wenn er sichtbar im Vordergrund ist.
HB: Genau, also wir haben zum Beispiel diese Leuchtkästen der Food-Serie oder diese Kinoleuchtkästen, die sind bestückt mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren. Falls es die nicht mehr geben sollte, kann ich mir auch vorstellen, dass man in diese Kästen andere Leuchtmittel einbringt, wie LEDs oder was es dann in Zukunft geben wird. Wenn das nach außen hin denselben Charakter hat, ist das überhaupt kein Problem. Das ist immer noch dieselbe Arbeit für mich. Wenn man Leuchtmittel außen sieht, dann ist es schwieriger, also zum Beispiel bei Kompositionen in Zeit und Raum gibt es tatsächlich Birnchen, die ich ausgesucht habe, oder bestimmte LEDs, die natürlich genauso aussehen sollten, die kann man nicht durch irgendein anderes LED austauschen. Also, wenn ich da ein rotes LED mit einem bestimmten Durchmesser habe, dann kann man da kein weißes oder blaues reinsetzen. Da muss man versuchen, dasselbe zu finden oder möglichst nah dran zu sein. Oder man muss sich irgendwas basteln, was dem entspricht.
EGC: Wenn jetzt zum Beispiel ein Lautsprecher oder ein Radioempfänger defekt wird. Oder spielen die optischen Teil keine Rolle?
HB: Doch, es gibt eine Arbeit, das ist so ein schwarzes Kreuz, an dessen Enden Lautsprecher integriert sind, und da gibt es natürlich das Problem, dass diese Lautsprecher wahrscheinlich im Lauf der Zeit zerbröseln werden. Ich habe zum Beispiel mir selber irgendwann mal eine Braun Stereoanlage gekauft aus den 70er-Jahren und die Firma Braun hatte zu der Zeit bei den Bässen Lautsprecher verwendet, die es einfach nicht geschafft haben bis heute zu halten und zu funktionieren. Die sind einfach alle zerfallen. Ich habe dann da andere gleichwertige Lautsprecher einbauen lassen, was nicht so das Problem ist, weil da noch mal so eine Blende drüber ist, aber eben bei so einer Arbeit wie dem Kreuz sind die sichtbar. Das sind eben solche schwarz-anthrazitfarbenen Membranlautsprecher, da müsste man natürlich versuchen es hinzukriegen, möglichst dieselben zu bekommen. Die wird es in 100 Jahren gar nicht mehr so geben, und dann entsteht natürlich ein Problem, wo ich Dir jetzt grad gar nicht sagen kann, wie man da verfährt. Also vielleicht hat man ja auch die Möglichkeit, diese Membran zu stabilisieren, wie auch immer. aber die Arbeit lebt natürlich davon, dass es genau die Lautsprecher sind, die auch diesen Sound absondern. Vielleicht schafft man es auch sie nachzubauen.
EGC: Jetzt zu den Textilien, zu den Arbeitsanzügen, T-Shirts, Hoods und Schals. Wie sieht es damit aus? Wenn jetzt zum Beispiel ein Ärmel an einem Arbeitsanzug beschädigt wird, also so in der Weise, bei der man sagen kann, ja, gut, okay, das ist ein Totalschaden, oder man versucht den Ärmel zu rekonstruieren?
HB: Also, wenn man es schafft, zum Beispiel das Material genau so wieder zu reproduzieren und zu färben oder man treibt irgendwo den Stoff auf oder man findet einen gleichen Arbeitsanzug und trennt da den Ärmel ab und ersetzt ihn, dann ist mir das lieber, als wenn der Ärmel fehlt. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, weil die Arbeiten ja an einer Stange an der Wand hängen und man nur die Rückseite sieht, dass man einfach von der Vorderseite ein Stück rausnimmt und es auf die sichtbare Seite bringt.
EGC: Das wäre für Dich in Ordnung?
HB: Ist nicht so eine schöne Vorstellung, aber wäre mir lieber, als alles nur so geflickt anzusehen.
EGC: Dieses Plastisol, was ist das eigentlich?
HB: Das ist eine Folie, die man aufbügelt. Zu der Zeit gab es noch nicht diese Computer-Schneide-Plotter. Ich habe es so gemacht, dass ich die Schrift auf dieses Plastisol konstruiert habe, dann habe ich es ausgeschnitten und schließlich aufgebügelt. Ich glaub mit dem Bügeleisen. Mittlerweile gibt es ja tausende von Folien, die man über einen Schneideplotter schneiden kann. Wenn man da einen Buchstaben reproduzieren müsste, könnte man ihn natürlich mit einer Folie, die dieselbe Färbung hat, ersetzen.
EGC: Da ist dann die Farbe das Problem und wahrscheinlich auch der Glanzgrad.
HB: Genau. Und man muss sehen, was für eine Form der Buchstabe hat, also damals habe ich die Schrift mit einem Cutter geschnitten, mit dem Lineal, und ich glaube, die Rundungen mit der Nagelschere. Da sollte man versuchen, diesen Charakter zu erhalten.
EGC: Und bei den T-Shirts und Hoods und Schals?
HB: Da wissen eigentlich Textilienrestauratoren am besten, wie man mit solchen Dingen umgeht, und wenn man sich an die ganzen Standards hält, macht man bestimmt nichts falsch. Da habe ich jetzt irgendwie keine Spezialanleitung.
EGC: Heiner, wie definierst Du einen Schaden? Wann betrachtest Du eine Veränderung an einem Kunstwerk als einen Schaden oder einen materialimmanenten, infolge eines Material, eines materialimmanenten Prozesses? Gibt es da bei Dir Unterscheidungen?
HB: Ja, also bisher war es so, dass meine Arbeiten nicht aus sich heraus etwas produziert haben, was ich als Schaden bezeichnen würde. Auf der anderen Seite kann man sagen, dass meine Arbeiten immer einen gewissen nicht-expressiven Charakter haben. Den sollten sie auf jeden Fall behalten, also eine bestimmte Hermetik, Kühle und Verschlossenheit, und auch den Moment, dass man bei den meisten Arbeiten nicht so etwas wie so einen künstlerischen Duktus sieht. Das ist mir sehr wichtig, und sobald eine Arbeit anfängt, sich in der Form zu verändern, dass eine gewisse Morbidität durch den Zerfall in den Vordergrund tritt, entsteht eine Wirkung, die gegen das läuft, was ich beabsichtigt habe. Da sollte man versuchen, dass so etwas nicht zu stark in den Vordergrund tritt. Es sollte vom Materialcharakter eigentlich doch das Industrielle behalten, wenn möglich.
EGC: Nun ist natürlich nicht zu verhindern, dass das Phänomen Patina auftritt.
HB: Ja.
EGC: Wie definierst Du Patina?
HB: Zum Beispiel bei diese Shaped Canvas-Bildern: Dadurch, dass ich keine Keilrahmenkonstruktion verwendet habe, ist die Leinwand schlaff geworden, und das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine schlaffe Leinwand irgendwo hängt. Das heißt, da muss man Mittel und Wege finden, damit dieses Bild praktisch nach vorne hin einfach stramm rüberkommt.
EGC: Okay. Und ferner gibt es ja das Phänomen, dass der Staub sich so stark mit dem Bildträger verbindet, so dass bei dessen Entfernung das Resultat, das man damit erzielt, fataler sein kann als zuvor. Könntest Du damit leben, dass das auch ein Erscheinungsbild ist, das so mit der Zeit entsteht?
HB: Wie ich es eben schon beschrieben habe, gibt es, glaube ich, einfach so einen bestimmten Schwellwert in der Wahrnehmung, bei dem der morbide Charakter durch solche Prozesse überwiegt. Dann würde ich sagen, weicht die Arbeit in der Ausstrahlung von der ursprünglichen Intention ab. Also, man sollte doch versuchen, diesen technischen Charakter zu erhalten. Ich habe zum Beispiel festgestellt, bei einem Künstler wie Joseph Beuys gibt es Arbeiten, die ich noch ganz neu erlebt habe, und die sich heute sehr stark unterscheiden vom Zustand ihrer Entstehung. Wenn man Material wie Fett oder Margarine verwendet oder Gummi, was sehr stark versprödet, oder Verpackungen aus der DDR-Zeit, die einfach mit schlechter Farbe gedruckt sind, dann bleich werden, das Papier wird braun, so ist das ein extrem anderer Charakter als der Material-Charakter zu der Zeit, als das Kunstwerk neu entstanden ist. Natürlich gehört bei Beuys diese Patina irgendwie auch mit dazu, die ist auch kalkuliert, aber bei meinen Arbeiten will ich mir das eigentlich eher nicht vorstellen. Da sollte es eigentlich in die Richtung gehen: »Wie sah das Kunstwerk aus, als es neu produziert wurde?«
EGC: Ähnliche Ansichten vertritt auch Reiner Ruthenbeck. Er sagt, er sei kein Maler, sondern er sei ein Konzeptkünstler, und er akzeptiere keine Spur von Patina an seinen Werken. Die sollen dem Betrachter immer so gegenübertreten, wie sie entstanden sind.
HB: Genau. Aber das kann man wirklich nicht pauschalisieren. Bei Beuys ist es ein Teil der Arbeiten, dass sie zerfallen, das muss man dann auch respektieren. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass man an diese Arbeit mit den DDR-Verpackungen drangeht und sagt, so, jetzt muss man alle Verpackungen neu drucken mit einer lichtfesten Farbe oder so, das ginge nicht.
EGC: Willst Du bei Auftreten eines Schadens informiert werden?
HB: Ja.
EGC: Interessieren Dich generell Fragen zur Konservierung und Restaurierung?
HB: Auch, ja.
EGC: Bist Du interessiert an Informationen zu neuen Materialitäten und Techniken, die Deinen Arbeitsbereich betreffen?
HB: Weiß nicht genau. In welche Richtung sollte das gehen?
EGC: Wenn es zum Beispiel Informationen gibt zu einer Entwicklung, zu bestimmten Materialien, die für Dich interessant sind.
HB: Gut, also das ist etwas Interessantes.
EGC: Aber da bist Du ja bestens selbst informiert und ein sehr guter Rechercheur. Ich denke, wir können mehr von Dir erfahren, wie Du von uns!
HB: Ja, es ist so, dass ich regelmäßig Messen besuche, wie Lichttechnik-Messen und Messen, die sich eher an Leute richten, die im Werbebereich tätig sind. Auf diesen Messen finde ich regelmäßig Materialien, aus denen dann später auch Arbeiten entstehen. Zum Beispiel dieses Orientierungssystem für die Deutsche Bank entstand einfach auf Grund von einer Begegnung mit einem Display auf einem Messestand, das ich dann zwei Jahre später dafür verwendet habe. Ich habe eine Zeitschrift abonniert, von der ich ein sehr großer Fan bin, die heißt »Werbetechnik« und erscheint alle zwei Monate, und da erfährt man die allerneuesten Entwicklungen im Bereich Computerdrucker, Großdisplaytechnik, Leuchtkästen, LEDs, Schneideplotter, dieser ganze Bereich, den ich sehr stark nutze. Das sauge ich auf wie ein Schwamm und das ist für mich eigentlich spannender, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen blasphemisch klingt, als das »Kunstforum« zu lesen (lacht). Da habe ich viel mehr Spaß dran.
EGC: Also, darin findest Du den Stoff, der möglicherweise Deine Kunstwerke bilden und formen wird.
HB: Mir macht das großen Spaß, mich damit zu beschäftigen, weil das ja alles auch Werkstoffe und technische Prozesse sind, die im Grunde genommen in einer relativ großen Unschuld produziert werden, die nie dazu gedacht waren, ein Kunstwerk zu werden. Das finde ich viel inspirierender, als jetzt bei Kremer auf irgendwelche Pigmenttüten zu gucken (lacht).
EGC: Gut, Heiner, zum Schluss noch eine persönliche Frage: Hat sich Deine Sicht auf die spezifische konservatorische und restauratorische Thematik durch die Beziehung zu Deiner Frau Helma, die Restauratorin ist, geändert?
HB: Na ja, die Helma ist da natürlich immer ein bisschen streng mit mir und guckt bei allem, was ich mache, mit ihrem restauratorischen Blick. Sie macht mich natürlich aufmerksam, wie sich Sachen entwickeln können, und da habe ich mittlerweile auch fast so was wie einen vorauseilenden Gehorsam entwickelt, so dass ich mir viel mehr Gedanken mache über diese ganzen Dinge. Und nicht zuletzt hat ja auch unsere Diskussion über diese Themen, die ja schon 15 Jahre – oder wie lange – andauert.
EGC: Seit 1988.
HB: Sie trugen auch dazu bei, dass ich diese ganze Geschichte im Auge habe. Ich versuche natürlich, die Arbeiten von vorne herein so zu konzipieren, dass dieser zeitliche Aspekt auch mitgedacht wird.


EGC: Heiner, herzlichen Dank. Das war sehr informativ, ja, nochmals vielen, vielen Dank.
HB: Jetzt könnten wir vielleicht diese Wollheim-Geschichte noch dranbauen?
EGC: Okay.
HB: Im Moment arbeite ich ja gerade an einem sehr komplexen Projekt, dem Wollheim Memorial, ein Holocaust Memorial für das ehemalige IG Farben Gelände.
Das besteht zum einen aus gravierten Bildtafeln, die im Park aufgestellt werden, zum anderen aber aus einem Infopavillon. In diesem Infopavillon befinden sich zwei Flachbildschirme. Auf einem dieser Flachbildschirme kann man 25 Interviews abrufen mit den Überlebenden aus dem IG Farben Lager Monowitz, und auf dem anderen hat man Zugang zu einem Webportal. Das ist eine Webseite, die ich eigens gestaltet habe und zusammen mit jungen Forschern, Historikern, redaktionell erarbeitet habe.
In Bezug auf die Komplexität der ganzen Geschichte und auch auf die Fragilität des Inhalts sind wir gerade dabei, einen Vertrag zu erarbeiten mit der Uni Frankfurt, die der Hausherr ist. In diesem Vertrag geht es darum, wie in Zukunft mit diesem Denkmal umgegangen wird. Da geht es zum einen um die Bildtafeln, wie werden die behandelt? Dürfen die versetzt werden? Wie geht man mit einem Schadensfall um? Und, und, und – das wird also alles praktisch vertraglich definiert. Auch in Bezug auf eine bestimmte Laufzeit, die natürlich aus meiner Perspektive möglichst lang sein sollte. Was diesen Pavillon betrifft, bin ich selber ein bisschen im Konflikt, weil der ursprünglich von Hans Poelzig gebaut wurde, vor dem ich natürlich höchsten künstlerischen Respekt habe. Dieser Pavillon ist aber nur noch zu Teilen im Urzustand. Da wurden irgendwann die Fenster und Türen ausgewechselt. Weiterhin wurde ich gezwungen, eine behindertengerechte Tür einzubauen. Das heißt, wir mussten die Tür verbreitern und die Poelzig-Proportionen verlassen. Aber da habe ich praktisch keine Wahl gehabt, das musste ich so machen, und ich habe versucht, möglichst verantwortungsvoll damit umzugehen. Dann gibt es von mir eine bestimmte Inneneinrichtung, bei der wir dann auch festschreiben wollen, dass die so zu bleiben hat, und wenn, dann nur in bestimmten Varianten, geändert werden kann. Dann habe ich die Bildschirmoberflächen gestaltet, auch die sollen so erhalten bleiben. Ich habe mit den Interviewern zusammen den Videoschnitt bestimmt, es gibt zusätzlich im Archiv eine Fassung mit dem kompletten Interview, die sind oft einen Tag lang. Wichtig ist aber die einstündige Fassung, die gezeigt wird, und auch mit den Interviewten abgestimmt wurde. Diese Schnittfassungen müssen respektiert werden. Da kann man nicht sagen, so, in zwei Jahren kürzen wir alles auf eine Viertelstunde. Das wäre ungefähr so, als wenn man von einem Bild etwas abschneiden würde und man zeigt dann nur einen Teil. Das muss abgesichert werden.
Besonders interessant und heikel wird es natürlich bei der Webgeschichte, weil diese Websachen natürlich immer lebendige Prozesse sind. Für die Webseite gibt es eine grafische Gestaltung, die von mir ist, und da ist mir sehr wichtig, dass die respektiert wird. Auf der anderen Seite gibt es redaktionelle Inhalte, bei denen es auch wichtig ist, dass die nicht nach Belieben umgeschrieben werden können. Da machen wir auch einen Vertrag, also, einerseits geht es um meine Gestaltung, und für die Autoren ist natürlich wichtig, in welcher Weise mit diesen Inhalten und mit der grafischen Oberfläche umgegangen wird. Natürlich ist es so, dass diese ganze Webgeschichte ein Prozess ist, der sich rasant entwickelt, und es kann sein, dass die Art von Gestaltung, die ich jetzt angelegt habe, die natürlich sehr stark mit den Möglichkeiten der Software und den aktuellen Browsern zu tun hat, dass die nach zehn Jahren obsolet ist. In der Form, dass man dann zum Beispiel Inhalte anders organisiert. Da sollte man natürlich mit mir sprechen und mir die Möglichkeit lassen, das dann selber umzugestalten oder mit einem Gestalter meiner Wahl das anders zu proportionieren. Da kommen wir natürlich in einen Bereich rein, wo man überhaupt nicht ahnen kann, was einem da blüht, und wo man letztendlich nicht im Detail alles definieren kann, was es da an Möglichkeiten alles geben wird. Aber Basis des Vertrags ist, dass man natürlich so weit wie möglich die ganzen gestalterischen Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe für dieses Denkmal, dass man die möglichst lange respektiert.

